Bis(s) das der Tod uns scheidet
Seite 1 von 1
 Bis(s) das der Tod uns scheidet
Bis(s) das der Tod uns scheidet
Es muss einfach sein. Meine Sucht zu schreiben ist einfach zu groß. Da ich die Bücher immer noch nicht gelesen habe und deshalb lediglich den Film kenne, habe ich mich dazu entschieden eine Geschichte zu schreiben, die ihren eigenen Charakter hat, aber nicht all zu intensiv in die eigentlich Handlung rund um die Cullens eingreift. Ich hoffe euch gefällt sie trotzdem.
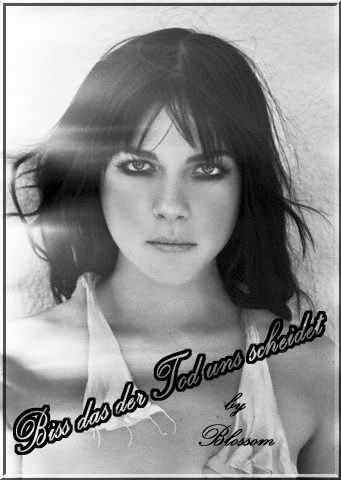
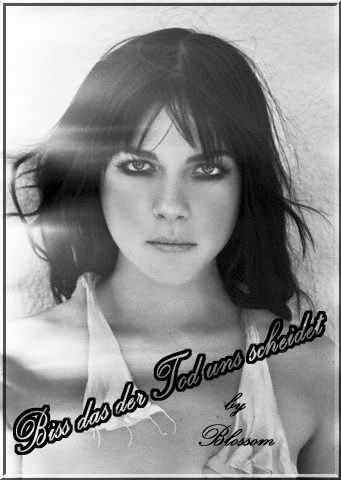
Kapitel 1
Manchmal kann ich mich noch daran erinnern, wie Schokolade schmeckt. Als Kind habe ich Schokolade geliebt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als kleines Mädchen alle möglichen Erledigungen tätigte, nur um später mit einer Praline oder einer Tasse heißer Schokolade entlohnt zu werden. Heute bleibt mir nur die Erinnerung an den süßlichen aber auch bitteren Geschmack, der sich langsam erst auf der Zunge und dann im ganzen Mund ausbreitet und ihn irgendwie taub macht. Ich weiß, dass das in einer Situation wie der meinen ein dummer und äußerst törichter Gedanke ist, aber er ist auch tröstlich. Er lenkt mich ab von den schlimmsten Schmerzen, die ich jemals erlebt habe und die mein Herz zum bluten bringen, es aufzufressen drohen.
Mit langsamen Bewegungen ließ ich mich auf meine Knie sinken. Der Boden war steif gefroren, doch Kälte erreicht mich nicht. Nur die Kälte in meinem Innersten begleitete mich an jedem Tag und in jeder Stunde. Fast schon zärtlich strich ich über den Grabstein aus Marmor und zog mit meinen Fingern sie Buchstaben nach, die man hinein gemeißelt hatte.
Colin Brightham war am Tage seines Todes 85 Jahre alt gewesen. Ein stolzes Alter, dem ein langes Leben voran gegangen war. Ein Leben, in dem er sein Vaterland im Krieg verteidigt hatte. Ein Leben, in dem er seiner Ehefrau ein guter Gatte gewesen war. Ein Mann, der Zeitlebens immer nur eine einzige Frau geliebt hatte, egal wie schwierig sich die Umstände dieser Liebe auch gestaltet hatten. Ein Mann der sich für andere eingesetzt und Notleidenden geholfen hat. In gewisser Weise würde ich behaupten, er hatte es verdient, in Ruhe zu sterben. Mit der Liebe seines Lebens an seiner Seite, die ihm die Hand hielt, als er den letzten Atemzug tat. Es war sein Recht gewesen und ich hatte es ihm gewährt. Doch das hinderte mich nicht daran den Tod und das Leben und alles was damit zu tun hatte zu verfluchen. Aber hatte ich nicht selbst so entschieden? War es nicht meine eigene Angst gewesen, die sich unserem gemeinsamen Leben in den Weg gestellt hatte? Hatte er mich nicht oft genug darum gebeten diesen einen Schritt zu gehen, der uns bis in alle Ewigkeit verbunden hätte?
Und nun saß ich hier und weinte heiße Tränen um meine verlorene Liebe, die man unwiederbringlich von mir genommen hatte. Genau wie all die anderen Menschen die ich in meinem Leben geliebt hatte, hatte man ihn mir weggenommen. Und doch war es in Colins Fall etwas anderes. Nie hatte ich einen Menschen so sehr geliebt wie ihn.
Ein lautes Schluchzen verließ meine Lippen und ich wischte mir mit dem Handrücken einige Tränen von den Wangen. Ich versuchte mich zu beherrschen und atmete immer wieder tief ein und aus, bis ich mich einigermaßen gefasst hatte und vorbeigehende Passanten aufhörten mich mit ihren Blicken zu durchbohren. Trotzdem musste ich immer wieder leise schniefen, während ich einzelne welke Blumen vom Grab aufsammelte und mich dann wieder erhob. Mit der rechten Hand klopfte ich mir ein paar Kieselsteine von der Hose und zog meinen langen schwarzen Mantel wieder glatt. Mein Blick glitt in den Himmel, der sich langsam verdunkelte und die Nacht Einzug erhielt. Es war Zeit nach Hause zu gehen, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht hier gesessen hätte und den folgenden Tag und den Tag darauf. Es nütze ja doch nichts. Ich entsorgte die welken Blumen in einer Abfalltonne und verließ dann den Friedhof durch das große schmiedeeiserne Tor.
Mein Atem bildete kleine weiße Wölkchen in der Kälte und ich fixierte mich darauf sie zu betrachten. Ich ließ keine Gelegenheit ungenutzt mich irgendwie abzulenken. Doch die Tage können so unendlich lang sein, wenn man sich nichts sehnlicher wünscht, als das sie endlich vorüber gehen. Den Gedanken an Colin und an all das, was ich unwiderruflich verloren hatte würde ich niemals ganz aus dem Weg gehen können. Ich zog den Heimweg mit Absicht künstlich in die Länge. Ich ging so langsam ich nur konnte, doch irgendwann gelangte ich doch an die Tür, hinter tausend Erinnerungen auf mich warteten. Ich seufzte und steckte den Schlüssel ins Schloss und stieß die Tür offen, die leise quietschte. Ich hatte dieses Haus seit fünf Tagen gemieden, doch nun musste ich eintreten und mich all meinen Dämonen stellen.
Die kalte Dunkelheit, die im Inneren des Hauses herrschte wurde nur von einem kleinen, roten Lichtlein durchbrochen, das mir signalisierte, dass auf meinem Anrufbeantworter neue Nachrichten auf mich warteten. Ich machte mir nicht die Mühe das Licht anzuschalten. Teilnahmslos öffnete ich erst die Gürtelschnalle an meinem Mantel und dann die Knöpfe. Ich stricht den schweren Stoff über meine Schultern und ließ das Kleidungsstück achtlos zu Boden gleiten. Auch die Mütze die ich trug zog ich von einem Kopf und ließ sie fallen. Wehmütig dachte ich daran, dass Colin sich über ein solches Verhalten sicher sehr aufgeregt hätte. Wir hätten uns wegen einer solchen Kleinigkeit wahrscheinlich sogar tierisch in die Haare bekommen und am Ende hätten wir beide den Streit bereut. Doch auch heftige Streits und unbedachte Worte würde es in der Zukunft nicht mehr geben und irgendwie fand ich das schade.
Gemächlich ging ich in die Hocke und hob einen Stapel Briefe auf, der vor dem Türschlitz lag. Ich sah die Post durch und warf sie schließlich auf die Kommode im Flur, um dann auch endlich den Knopf am Anrufbeantworter zu drücken, der dafür sorgte, dass die dort gespeicherten Nachrichten wieder gegeben wurden und das aggressive, rote Blinken endlich aufhörte.
Jo? Hier ist Holly! Ich hab dich heute in der Uni vermisst. Meld dich mal!
Hallo Jo! Hier ist Holly nochmal. Ich hab gerade von Keith erfahren, dass dein Großvater gestorben ist. Das tut mir leid. Wenn du jemanden zum quatschen brauchst, ruf mich einfach an. Und mach dir keine Sorgen, ich sammel alle wichtigen Zettel für dich ein.
„Mein Großvater“, flüsterte ich leise und lehnte mich an die gegenüberliegende Wand. Wieder bildeten sich Tränen in meinen Augen und ich konnte spüren, wie sich die Muskeln in einem Körper vor Zorn und Trauer und unerfüllter Sehnsüchte anspannten. Mein Großvater. Wie oft hatte ich Colin damit geneckt, wenn ich ihn in der Öffentlichkeit als meinen Grandpa vorstellte. Wie habe ich es genossen wenn ich seine Zähne knirschen hörte, während er sich zusammenriss, damit er nicht aus seiner Rolle fiel.
Hallo? Hallo Jo? Holly schon wieder. Bist du Zuhause? Geh doch dran! – Hm dann ruf ich später noch einmal an.
Joanna Brightham! Nun ruf mich verflixt noch einmal endlich an. Du bist seit einer Woche nicht mehr in der Uni gewesen. Wir schreiben am Montag eine Prüfung und ich hab Unterlagen für dich, die dafür wichtig sind. Bitte melde dich bei mir. Ich weiß, dass du und dein Großvater euch sehr nahe gestanden habt, aber es nützt doch nichts deswegen Trübsal zu blasen. Das Leben geht weiter, Jo.
„GAR NICHTS WEISST DU!“, schrie ich wütend in die Dunkelheit und fegte das Telefon samt Anrufbeantworter von der Kommode. Mit einem lauten Knall flogen die Elektrogeräte gegen die Wand am anderen Ende des Flures und zersprangen dort in ihre Einzelteile. Irgendeines der Geräte gab noch ein paar seltsame Pfeifgeräusche von sich und dann kehrte endlich wieder Stille ein. Und ich stand einfach nur da und wusste weder ein noch aus. Mein Brustkorb hob und senkte sich angestrengt und ich hörte mein eigenes schweres Schnaufen.
Ich musste hier weg. Nicht nur raus aus diesem Haus, sondern ganz weg. Weg aus New Castle. Weg aus England. Aber wohin sollte ich gehen? An wen sollte ich mich wenden? Ich hatte in den letzten Jahren fast ausschließlich Kontakt zu Colin gehabt. Von meinen Studienkollegen einmal abgesehen, aber die zählten nicht. Gut, da gab es Holly mit der ich mich immer wirklich gut verstanden hatte und die mir so manches Mal eine gute Freundin gewesen war, aber auch ihr würde über kurz oder lang nicht verborgen bleiben, dass ich mich einfach weigerte zu altern. Sie maulte ja jetzt schon darüber, dass sie bereits die ersten Falten bei sich entdeckte und meine Haut nicht eine einzige Furche aufwies. Früher oder später würde ich New Castle auf jeden Fall verlassen müssen und früher erschien mir in diesem Moment als die klügere Wahl. Vielleicht war es nun langsam an der Zeit, dass ich mich wieder unter Meinesgleichen gesellte, ich sollte endlich damit abschließen ständig zu versuchen, ein ganz normaler Mensch zu sein. Ich war eben keiner und würde auch nie wieder einer sein. Und das Leben, das ich versucht hatte so zu führen, lag nun in Scherben zu meinen Füßen und bereitete mir nichts als Schmerz.
Mein Entschluss stand also fest. Ich musste raus aus England und zurück zu Meinesgleichen. Aber wo war Meinesgleichen zu finden? Das letzte Mal traf ich einen Vampir vor über dreißig Jahren, als ich und Colin eine Reise nach Finnland unternommen hatten. Und dieser war mir nicht gerade wohlgesonnen gewesen, aufgrund meiner Einstellung die ich gegenüber den Menschen hegte. Ich musste also nicht nur andere Vampire ausfindig machen, sondern auch eben solche, die Toleranz dafür aufbrachten, dass ich den Verzehr von Menschenblut ablehnte. Unbewusst begann ich mir die Schläfen zu reiben, so wie Holly es immer tat wenn sie überlegte und es schien zu funktionieren, denn ich hatte tatschlich eine Idee. Das Internet. Ein Kommilitone von mir, der zugegebenermaßen etwas durchgeknallt war, hatte mir einmal etwas erzählt von verschiedenen Websites, die sich mit den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien auseinandersetzen. Unter anderen fiel dabei auch der Begriff Vampire. Ich hatte ihn damals nur belächelt. Zum einen, weil er einfach ein Spinner war und zum anderen, weil ich nun einmal ein Vampir war und keine Verschwörungstheorie. Aber das konnte er ja nicht wissen. Aber an jeder Verschwörungstheorie hängt nun einmal auch ein klein wenig Wahrheit und wenn dem so war, dann war es vielleicht möglich über eine solche Seite Kontakt zu anderen Vampiren aufzunehmen.
Es bedurfte mich nur den Bruchteil einer Sekunde, um die Treppenstufen zu erklimmen und das Arbeitszimmer zu betreten. Sofort umfing mich der mystische Duft meiner geliebten Bücher und schenkte mir wenigstens für einen kurzen Augenblick so etwas wie Geborgenheit. In meinen Büchern konnte ich mich verlieren, konnte mir einbilden, das Leben sei ein Abenteuer. Realitätsflucht nennt man sowas wohl. Das Leben war nun einmal kein Abenteuer, kein Roman, keine Fiktion, es war ein harter Kampf. Ich musste der Versuchung wiederstehen mich in den großen, gemütlichen Sessel fallen zu lassen und einfach mit Odysseus davon zu segeln. Dafür hatte ich schließlich später noch genug Zeit. Eine Ewigkeit, um genau zu sein. Stattdessen schaltete ich den Computer an und setzte mich an den Schreibtisch. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis der alte PC sich endlich hochgefahren hatte und die Internetleitung stand, doch als es endlich so weit war, hatte ich keine Ahnung, wonach genau ich eigentlich suchen sollte.
Naiv gab ich das Wort ‚Vampire‘ in eine Suchmaschine ein und bekam eine Auswahl von mehren Millionen Websites vorgelegt. Ich fügte noch das Wort ‚Verschwörungstheorie‘ hinzu und das Angebot reduzierte sich auf mehre Tausend Seiten, die sich mit diesem Thema beschäftigten. Ich verbrachte die ganze Nacht vor dem Computer, aber ich fand nichts, was mir wirklich von Nutzen sein konnte. Zu guter letzt blieb ich schließlich an einem Artikel hängen, der sich um wilde Vertuschungstheorien drehte. Ein Mädchen in Phoenix hatte einen schweren Unfall erlitten, und nun wurde gemutmaßt, dass Vampire etwas damit zu tun haben könnten. Ich rang mir ein schwaches Lächeln ab und studierte das Bild des Mädchens eingehender. Sie war hübsch. Langes, dunkles Haar, weiche, feminine Gesichtszüge. Vor allem aber war es ihr tiefer, unergründlicher Blick, der mein Interesse auf sich zog. Sie war auf jeden Fall kein Vampir, aber ihr Blick ähnelte ein wenig dem von Collin, als ich ihn vor Jahren über meine Identität aufgeklärt hatte.
Ich überflog den Abgebildeten Zeitungsartikel ein weiteres Mal und entschied mich dann, ihren Namen ebenfalls in die Suchmaschine einzugeben. ‚Isabella Swan‘. Dieses Mal wurden mir nur ein paar wenige Seiten aufgelistet und die alle handelten von ihrem Unfall. Alle bis auf eine. Und obwohl ich stark bezweifelte, das mir die Homepage einer kleinen, amerikanischen Provinzhighschool bei meiner Suche irgendwie weiterhelfen würde, klickte ich auf den Link. Ich beschloss, das Fotoarchiv der Schule zu durchstöbern. Das war zwar nicht sonderlich produktiv, aber es bot mir Ablenkung. Begleitet von einem Tropfen Wehmut betrachtete ich die Bilder von glücklichen Jugendlichen, die ausgiebig lachten und das Leben genossen. Die Fotos waren auf einem Schulball geschossen worden und wahrscheinlich hatte keine der abgelichteten Personen, an diesem Tag auch nur einen einzigen Gedanken an den Tod verschwendet. Und wer konnte es ihnen verdenken? Sie waren schließlich jung, frei und unbeschwert und ihre Herzen voller Freude und Wünschen.
Auf einem Bild entdeckte ich dann auch dieses Mädchen, diese Isabella wieder. Gemeinsam mit einem Jungen posierte sie für die Kamera. Ich legte den Kopf etwas schief. Wie gebannt starrte ich den Bildschirm an. Konnte das wahr sein? Konnte das wirklich wahr sein oder versuchte mein leidgeplagtes Herz mich zu täuschen? Mehrmals blinzelte ich mit den Augen. Realität oder Illusion?
Wenn man einen Menschen über mehrere Jahre, über Jahrzehnte, ja fast sogar Jahrhunderte nicht mehr gesehen hatte, dann verblasst die Erinnerung an sein Gesicht langsam. Doch jetzt sah ich ihn wieder gestochen scharf vor mir. Gestochen scharf auf dem Foto das erst vor wenigen Wochen auf einem Schulball geschossen worden war. Das konnte nicht sein. Ich musste mich täuschen. Edward war tot…
Mit langsamen Bewegungen ließ ich mich auf meine Knie sinken. Der Boden war steif gefroren, doch Kälte erreicht mich nicht. Nur die Kälte in meinem Innersten begleitete mich an jedem Tag und in jeder Stunde. Fast schon zärtlich strich ich über den Grabstein aus Marmor und zog mit meinen Fingern sie Buchstaben nach, die man hinein gemeißelt hatte.
Colin Brightham
1920 bis 2005
Geliebt bis in alle Ewigkeit
1920 bis 2005
Geliebt bis in alle Ewigkeit
Colin Brightham war am Tage seines Todes 85 Jahre alt gewesen. Ein stolzes Alter, dem ein langes Leben voran gegangen war. Ein Leben, in dem er sein Vaterland im Krieg verteidigt hatte. Ein Leben, in dem er seiner Ehefrau ein guter Gatte gewesen war. Ein Mann, der Zeitlebens immer nur eine einzige Frau geliebt hatte, egal wie schwierig sich die Umstände dieser Liebe auch gestaltet hatten. Ein Mann der sich für andere eingesetzt und Notleidenden geholfen hat. In gewisser Weise würde ich behaupten, er hatte es verdient, in Ruhe zu sterben. Mit der Liebe seines Lebens an seiner Seite, die ihm die Hand hielt, als er den letzten Atemzug tat. Es war sein Recht gewesen und ich hatte es ihm gewährt. Doch das hinderte mich nicht daran den Tod und das Leben und alles was damit zu tun hatte zu verfluchen. Aber hatte ich nicht selbst so entschieden? War es nicht meine eigene Angst gewesen, die sich unserem gemeinsamen Leben in den Weg gestellt hatte? Hatte er mich nicht oft genug darum gebeten diesen einen Schritt zu gehen, der uns bis in alle Ewigkeit verbunden hätte?
Und nun saß ich hier und weinte heiße Tränen um meine verlorene Liebe, die man unwiederbringlich von mir genommen hatte. Genau wie all die anderen Menschen die ich in meinem Leben geliebt hatte, hatte man ihn mir weggenommen. Und doch war es in Colins Fall etwas anderes. Nie hatte ich einen Menschen so sehr geliebt wie ihn.
Ein lautes Schluchzen verließ meine Lippen und ich wischte mir mit dem Handrücken einige Tränen von den Wangen. Ich versuchte mich zu beherrschen und atmete immer wieder tief ein und aus, bis ich mich einigermaßen gefasst hatte und vorbeigehende Passanten aufhörten mich mit ihren Blicken zu durchbohren. Trotzdem musste ich immer wieder leise schniefen, während ich einzelne welke Blumen vom Grab aufsammelte und mich dann wieder erhob. Mit der rechten Hand klopfte ich mir ein paar Kieselsteine von der Hose und zog meinen langen schwarzen Mantel wieder glatt. Mein Blick glitt in den Himmel, der sich langsam verdunkelte und die Nacht Einzug erhielt. Es war Zeit nach Hause zu gehen, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht hier gesessen hätte und den folgenden Tag und den Tag darauf. Es nütze ja doch nichts. Ich entsorgte die welken Blumen in einer Abfalltonne und verließ dann den Friedhof durch das große schmiedeeiserne Tor.
Mein Atem bildete kleine weiße Wölkchen in der Kälte und ich fixierte mich darauf sie zu betrachten. Ich ließ keine Gelegenheit ungenutzt mich irgendwie abzulenken. Doch die Tage können so unendlich lang sein, wenn man sich nichts sehnlicher wünscht, als das sie endlich vorüber gehen. Den Gedanken an Colin und an all das, was ich unwiderruflich verloren hatte würde ich niemals ganz aus dem Weg gehen können. Ich zog den Heimweg mit Absicht künstlich in die Länge. Ich ging so langsam ich nur konnte, doch irgendwann gelangte ich doch an die Tür, hinter tausend Erinnerungen auf mich warteten. Ich seufzte und steckte den Schlüssel ins Schloss und stieß die Tür offen, die leise quietschte. Ich hatte dieses Haus seit fünf Tagen gemieden, doch nun musste ich eintreten und mich all meinen Dämonen stellen.
Die kalte Dunkelheit, die im Inneren des Hauses herrschte wurde nur von einem kleinen, roten Lichtlein durchbrochen, das mir signalisierte, dass auf meinem Anrufbeantworter neue Nachrichten auf mich warteten. Ich machte mir nicht die Mühe das Licht anzuschalten. Teilnahmslos öffnete ich erst die Gürtelschnalle an meinem Mantel und dann die Knöpfe. Ich stricht den schweren Stoff über meine Schultern und ließ das Kleidungsstück achtlos zu Boden gleiten. Auch die Mütze die ich trug zog ich von einem Kopf und ließ sie fallen. Wehmütig dachte ich daran, dass Colin sich über ein solches Verhalten sicher sehr aufgeregt hätte. Wir hätten uns wegen einer solchen Kleinigkeit wahrscheinlich sogar tierisch in die Haare bekommen und am Ende hätten wir beide den Streit bereut. Doch auch heftige Streits und unbedachte Worte würde es in der Zukunft nicht mehr geben und irgendwie fand ich das schade.
Gemächlich ging ich in die Hocke und hob einen Stapel Briefe auf, der vor dem Türschlitz lag. Ich sah die Post durch und warf sie schließlich auf die Kommode im Flur, um dann auch endlich den Knopf am Anrufbeantworter zu drücken, der dafür sorgte, dass die dort gespeicherten Nachrichten wieder gegeben wurden und das aggressive, rote Blinken endlich aufhörte.
Jo? Hier ist Holly! Ich hab dich heute in der Uni vermisst. Meld dich mal!
Hallo Jo! Hier ist Holly nochmal. Ich hab gerade von Keith erfahren, dass dein Großvater gestorben ist. Das tut mir leid. Wenn du jemanden zum quatschen brauchst, ruf mich einfach an. Und mach dir keine Sorgen, ich sammel alle wichtigen Zettel für dich ein.
„Mein Großvater“, flüsterte ich leise und lehnte mich an die gegenüberliegende Wand. Wieder bildeten sich Tränen in meinen Augen und ich konnte spüren, wie sich die Muskeln in einem Körper vor Zorn und Trauer und unerfüllter Sehnsüchte anspannten. Mein Großvater. Wie oft hatte ich Colin damit geneckt, wenn ich ihn in der Öffentlichkeit als meinen Grandpa vorstellte. Wie habe ich es genossen wenn ich seine Zähne knirschen hörte, während er sich zusammenriss, damit er nicht aus seiner Rolle fiel.
Hallo? Hallo Jo? Holly schon wieder. Bist du Zuhause? Geh doch dran! – Hm dann ruf ich später noch einmal an.
Joanna Brightham! Nun ruf mich verflixt noch einmal endlich an. Du bist seit einer Woche nicht mehr in der Uni gewesen. Wir schreiben am Montag eine Prüfung und ich hab Unterlagen für dich, die dafür wichtig sind. Bitte melde dich bei mir. Ich weiß, dass du und dein Großvater euch sehr nahe gestanden habt, aber es nützt doch nichts deswegen Trübsal zu blasen. Das Leben geht weiter, Jo.
„GAR NICHTS WEISST DU!“, schrie ich wütend in die Dunkelheit und fegte das Telefon samt Anrufbeantworter von der Kommode. Mit einem lauten Knall flogen die Elektrogeräte gegen die Wand am anderen Ende des Flures und zersprangen dort in ihre Einzelteile. Irgendeines der Geräte gab noch ein paar seltsame Pfeifgeräusche von sich und dann kehrte endlich wieder Stille ein. Und ich stand einfach nur da und wusste weder ein noch aus. Mein Brustkorb hob und senkte sich angestrengt und ich hörte mein eigenes schweres Schnaufen.
Ich musste hier weg. Nicht nur raus aus diesem Haus, sondern ganz weg. Weg aus New Castle. Weg aus England. Aber wohin sollte ich gehen? An wen sollte ich mich wenden? Ich hatte in den letzten Jahren fast ausschließlich Kontakt zu Colin gehabt. Von meinen Studienkollegen einmal abgesehen, aber die zählten nicht. Gut, da gab es Holly mit der ich mich immer wirklich gut verstanden hatte und die mir so manches Mal eine gute Freundin gewesen war, aber auch ihr würde über kurz oder lang nicht verborgen bleiben, dass ich mich einfach weigerte zu altern. Sie maulte ja jetzt schon darüber, dass sie bereits die ersten Falten bei sich entdeckte und meine Haut nicht eine einzige Furche aufwies. Früher oder später würde ich New Castle auf jeden Fall verlassen müssen und früher erschien mir in diesem Moment als die klügere Wahl. Vielleicht war es nun langsam an der Zeit, dass ich mich wieder unter Meinesgleichen gesellte, ich sollte endlich damit abschließen ständig zu versuchen, ein ganz normaler Mensch zu sein. Ich war eben keiner und würde auch nie wieder einer sein. Und das Leben, das ich versucht hatte so zu führen, lag nun in Scherben zu meinen Füßen und bereitete mir nichts als Schmerz.
Mein Entschluss stand also fest. Ich musste raus aus England und zurück zu Meinesgleichen. Aber wo war Meinesgleichen zu finden? Das letzte Mal traf ich einen Vampir vor über dreißig Jahren, als ich und Colin eine Reise nach Finnland unternommen hatten. Und dieser war mir nicht gerade wohlgesonnen gewesen, aufgrund meiner Einstellung die ich gegenüber den Menschen hegte. Ich musste also nicht nur andere Vampire ausfindig machen, sondern auch eben solche, die Toleranz dafür aufbrachten, dass ich den Verzehr von Menschenblut ablehnte. Unbewusst begann ich mir die Schläfen zu reiben, so wie Holly es immer tat wenn sie überlegte und es schien zu funktionieren, denn ich hatte tatschlich eine Idee. Das Internet. Ein Kommilitone von mir, der zugegebenermaßen etwas durchgeknallt war, hatte mir einmal etwas erzählt von verschiedenen Websites, die sich mit den unterschiedlichsten Verschwörungstheorien auseinandersetzen. Unter anderen fiel dabei auch der Begriff Vampire. Ich hatte ihn damals nur belächelt. Zum einen, weil er einfach ein Spinner war und zum anderen, weil ich nun einmal ein Vampir war und keine Verschwörungstheorie. Aber das konnte er ja nicht wissen. Aber an jeder Verschwörungstheorie hängt nun einmal auch ein klein wenig Wahrheit und wenn dem so war, dann war es vielleicht möglich über eine solche Seite Kontakt zu anderen Vampiren aufzunehmen.
Es bedurfte mich nur den Bruchteil einer Sekunde, um die Treppenstufen zu erklimmen und das Arbeitszimmer zu betreten. Sofort umfing mich der mystische Duft meiner geliebten Bücher und schenkte mir wenigstens für einen kurzen Augenblick so etwas wie Geborgenheit. In meinen Büchern konnte ich mich verlieren, konnte mir einbilden, das Leben sei ein Abenteuer. Realitätsflucht nennt man sowas wohl. Das Leben war nun einmal kein Abenteuer, kein Roman, keine Fiktion, es war ein harter Kampf. Ich musste der Versuchung wiederstehen mich in den großen, gemütlichen Sessel fallen zu lassen und einfach mit Odysseus davon zu segeln. Dafür hatte ich schließlich später noch genug Zeit. Eine Ewigkeit, um genau zu sein. Stattdessen schaltete ich den Computer an und setzte mich an den Schreibtisch. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis der alte PC sich endlich hochgefahren hatte und die Internetleitung stand, doch als es endlich so weit war, hatte ich keine Ahnung, wonach genau ich eigentlich suchen sollte.
Naiv gab ich das Wort ‚Vampire‘ in eine Suchmaschine ein und bekam eine Auswahl von mehren Millionen Websites vorgelegt. Ich fügte noch das Wort ‚Verschwörungstheorie‘ hinzu und das Angebot reduzierte sich auf mehre Tausend Seiten, die sich mit diesem Thema beschäftigten. Ich verbrachte die ganze Nacht vor dem Computer, aber ich fand nichts, was mir wirklich von Nutzen sein konnte. Zu guter letzt blieb ich schließlich an einem Artikel hängen, der sich um wilde Vertuschungstheorien drehte. Ein Mädchen in Phoenix hatte einen schweren Unfall erlitten, und nun wurde gemutmaßt, dass Vampire etwas damit zu tun haben könnten. Ich rang mir ein schwaches Lächeln ab und studierte das Bild des Mädchens eingehender. Sie war hübsch. Langes, dunkles Haar, weiche, feminine Gesichtszüge. Vor allem aber war es ihr tiefer, unergründlicher Blick, der mein Interesse auf sich zog. Sie war auf jeden Fall kein Vampir, aber ihr Blick ähnelte ein wenig dem von Collin, als ich ihn vor Jahren über meine Identität aufgeklärt hatte.
Ich überflog den Abgebildeten Zeitungsartikel ein weiteres Mal und entschied mich dann, ihren Namen ebenfalls in die Suchmaschine einzugeben. ‚Isabella Swan‘. Dieses Mal wurden mir nur ein paar wenige Seiten aufgelistet und die alle handelten von ihrem Unfall. Alle bis auf eine. Und obwohl ich stark bezweifelte, das mir die Homepage einer kleinen, amerikanischen Provinzhighschool bei meiner Suche irgendwie weiterhelfen würde, klickte ich auf den Link. Ich beschloss, das Fotoarchiv der Schule zu durchstöbern. Das war zwar nicht sonderlich produktiv, aber es bot mir Ablenkung. Begleitet von einem Tropfen Wehmut betrachtete ich die Bilder von glücklichen Jugendlichen, die ausgiebig lachten und das Leben genossen. Die Fotos waren auf einem Schulball geschossen worden und wahrscheinlich hatte keine der abgelichteten Personen, an diesem Tag auch nur einen einzigen Gedanken an den Tod verschwendet. Und wer konnte es ihnen verdenken? Sie waren schließlich jung, frei und unbeschwert und ihre Herzen voller Freude und Wünschen.
Auf einem Bild entdeckte ich dann auch dieses Mädchen, diese Isabella wieder. Gemeinsam mit einem Jungen posierte sie für die Kamera. Ich legte den Kopf etwas schief. Wie gebannt starrte ich den Bildschirm an. Konnte das wahr sein? Konnte das wirklich wahr sein oder versuchte mein leidgeplagtes Herz mich zu täuschen? Mehrmals blinzelte ich mit den Augen. Realität oder Illusion?
Wenn man einen Menschen über mehrere Jahre, über Jahrzehnte, ja fast sogar Jahrhunderte nicht mehr gesehen hatte, dann verblasst die Erinnerung an sein Gesicht langsam. Doch jetzt sah ich ihn wieder gestochen scharf vor mir. Gestochen scharf auf dem Foto das erst vor wenigen Wochen auf einem Schulball geschossen worden war. Das konnte nicht sein. Ich musste mich täuschen. Edward war tot…
Zuletzt von Blossom am Sa 30 Jan 2010, 21:46 bearbeitet; insgesamt 10-mal bearbeitet
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 2
Rückblick
Die Öllichter an den Wänden tauchten den langen Flur, mit seiner dunklen Holzvertäfelung in ein gruseliges Licht. Die flackernden Flammen tanzten geradezu und zauberten eine Vielzahl von Schatten an die Wände, die meiner reichhaltigen Fantasie sicherlich eine Menge Nahrung geboten hätten. Aber nicht heute. Nicht an diesem Abend. Ich hatte mich im Schatten auf der Treppe ganz klein gemacht, damit mich niemand entdeckte und blickte gebannt auf die nicht ganz geschlossene Tür zum Arbeitszimmer meines Onkels. Die Tür war nicht weit genug geöffnet, um etwas anderes zu erkennen als die Umrisse von Menschen die hin und wieder an diesem Spalt vorbei huschten, aber doch weit genug, das ich hören konnte, worüber gesprochen wurde.
„Ich nehme übermorgen den Zug nach New York und von dort aus ein Schiff nach Le Havre“, ertönte die Stimme meiner Mutter im flüssigsten Englisch, was mich ein wenig erstaunte, da sie mit mir immer nur Französisch gesprochen hat. Wenn sie überhaupt ab und zu Mal das Wort an mich richtete.
„Das kannst du nicht machen!“, herrschte mein Onkel sie an und ich brauchte nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, wie seine mächtige Faust auf die Holzplatte seines Schreibtisches donnerte. „Mein Bruder ist gerade einmal eine Woche tot. Sein Leichnam gerade erst unter der Erde und du willst schon das Land verlassen?“
„Das Eheversprechen an Ernest, das ich gezwungen wurde zu geben, war das einzige, was mich hier gehalten hat. Jetzt ist er tot und es beliebt mir zu gehen, wohin ich will.“
„Wie kannst du nur so kaltherzig sein?“ Die Stimme meiner Tante erzitterte unter einem leisen Schluchzen. „Ernest hat immer alles für dich getan. Er hat dich geliebt und geheiratet, obwohl du dich von einem anderen Mann hast schwängern lassen.“
„Einen Mann den ich geliebt habe und den man mir entrissen hat“, fauchte meine Mutter sie an und mir stockte der Atem.
Ich war vielleicht erst acht Jahre alt, aber ich war kein Dummkopf. Ich hatte die Worte, die gesprochen wurde genau verstanden und doch ergaben sie in meine Kopf keinen Sinn. Wenn meine Mutter bereits von einem anderen Mann schwanger gewesen war, als sie Ernest Masen geheiratet hat, dann bedeutete das, dass der Mann, den ich für meinen Vater gehalten hatte, den ich geliebt und verehrt hatte und der nun tot war, gar nicht mein Vater war. Ich sog laut stark die Luft in meine Lungen und fürchtete für einen kurzen Moment, dieses pure Einatmen wäre so laut gewesen, das man es im ganzen Haus hätte hören können. Doch niemand nahm Notiz von mir.
„Das kannst du einfach nicht machen, Giselle!“, ließ sich meine Tante nicht unterkriegen und erhob ihre Stimme. „Denk doch auch mal an Anni. Sie ist doch gerade erst acht und hier aufgewachsen. Sie wird Probleme haben, sich in einer neuen Umgebung, einem neuen Land, in dem man eine ganz andere Sprache spricht zurecht zu finden.“
„Mach dir um Joanna keine Sorgen. Sie wird nicht mitkommen. Ich habe für sie einen Platz im Nonnenkloster von Saint Joseph.“
„Das ist doch wohl der Gipfel der Unglaublichkeiten!“ Wider knallte die Faust meines Onkels auf den Tisch. Dieses Mal mit einer solchen Gewalt, das ich die Gegenstände, die darauf standen klirren hören konnte. „Du wirst Anni ganz sicher nicht in ein Kloster abschieben!“
In meinem Kopf breitete sich langsam ein leises Summen aus. Diese leise Melodie, die sich immer dann abspielte, wenn Dinge gesagt wurden, die ich nicht hören wollte. Zum Beispiel als man mir vor einer Woche sagt mein Vater wäre gestorben, da habe ich dieses Summen ganz deutlich gehört. Es beginnt ganz leise und wird dann langsam aber stetig immer lauter. Doch jetzt wollte ich dieses Lied nicht hören. Ich wollte hören, was gesagt wurde. Ich war völlig geschockt über den Verlauf der Dinge, doch ich musste einfach weiter zuhören. Hier ging es schließlich um mich. Hier wurden Entscheidungen über mein Leben getroffen, und niemand schien es für nötig zu halten, mich nach meiner Meinung zu fragen. Ein Kloster. Ich war einfach fassungslos. Ich habe nie verstanden, was ich ihr getan haben könnte, doch so sehr ich mich auch bemühte die Liebe meiner Mutter zu erwecken, ich erntete immer nur Distanz. Schlimmer noch. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, sie empfände meine Nähe als abstoßend und sie musste sich regelrecht zusammen reißen, um nicht zu spucken. Das ihre Abneigung gegen mich allerdings so stark war, dass sie mich in ein Kloster stecken wollte, das hatte ich noch nicht einmal ansatzweise geahnt. Das konnte sie doch nicht tun. Mit eisernem Griff umklammerte ich das Treppengeländer so stark, dass meine Fingerknöchel ganz weiß wurden. Mein Blick allerdings blieb starr auf die Tür zum Arbeitszimmer gerichtet.
„Falls ich dich mal kurz über die Gegebenheiten aufklären dürfte, Schwager. Joanna ist mein Kind und ich kann mit meinem Kind machen was ich will.“
„Du bist der herzloseste Mensch den ich kenne.“ Meine Tante, die eben noch rasend vor Wut geschrien hatte sprach nun ganz leise und heiser.
„Du weißt doch nicht wie das ist, Elisabeth!“ Die Stimme meiner Mutter nahm etwas Bedrohliches an. Ähnlich dem Geräusch, das eine Schlange macht, bevor sie zubeißt. „Jedes Mal wenn ich in das Gesicht dieses Kindes sehe, sehe ich was man mir genommen hat. Glaubst du ich bin mir nicht bewusst, dass ich aus gekränkter Eitelkeit eine schlechte Mutter bin? Glaubst du nicht, ich hätte es niemals versucht? Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht in ihr Gesicht sehen ohne an ihn zu denken. Sie wird es in einem Kloster besser haben, als bei mir.“
„Sie wird eingehen! Wenn du dieses Kind in ein Kloster steckst, wird sie eingehen“, versuchte meine Tante ein letztes Mal auf meine Mutter einzureden, doch ihre Stimme war mittlerweile so leise und von Tränen gefüllt, das man sie kaum noch hören konnte.
„Ich weiß überhaupt nicht, was du dich plötzlich so um dieses Kind scherst. Du bist doch in keinerlei Weise mit ihr verwandt.“
„Das Blut nicht immer dicker ist als Wasser, das beweist du doch nur zu gut. Bevor du Anni in ein Kloster gibst, bleibt sie bei uns!“
In meinem Kopf herrschte ein heilloses Durcheinander. Erst wollte meine Mutter mich in ein Kloster abschieben und sich selbst nach Frankreich absetzen. Dann erfuhr ich, dass der Mann, den ich so viele Jahre für meinen Vater gehalten habe gar nicht mein Vater ist und dass meine Mutter mich deshalb nicht liebt. Und nun wurde darüber verhandelt, wo ich denn nun verbleiben soll. In diesem Moment wurde ich mir das erste Mal darüber klar, warum man Gespräche anderer Leute nicht belauschen sollte. Trotzdem fiel es mir von Sekunde zu Sekunde schwerer, auf meinem Platz im Schatten sitzen zu bleiben. Zu gerne hätte ich das Arbeitszimmer gestürmt und allen meine Meinung zu diesem ganzen Thema ins Gesicht geschriene. Aber dann hätte ich mit Sicherheit großen Ärger bekommen und wahrscheinlich hätte sich auch niemand für meine Meinung - die Meinung eines Kindes – interessiert. Und dabei ging es hier doch die ganze Zeit um mich. Um mich und um mein Leben. Erste Tränen der Verzweiflung suchten sich ihren Weg aus meinen Augenwinkeln und liefen stumm über meine geröteten Wangen, die sich so heißer als Feuer anfühlten.
„Gut, wenn du das Kind unbedingt haben willst. Für 200 Dollar ist es deins.“
Die Worte meiner Mutter schienen in den Gemäuern des alten Hauses wieder zu hallen und trotzdem legte sich plötzlich eine bleierne Schwere über die bereits herrschende Nacht. Das hatte sie nicht gesagt. Nein, das konnte sie einfach nicht gesagt haben. Sie war doch meine Mutter. Verletzte Eitelkeit, verletzter Stolz, unerfüllte Liebe hin oder her. Sie war doch meine Mutter. Ich musste schluchzen und hielt mir meine zitternden Hände vor den Mund. Ich hätte mir nichts sehnlicher gewünscht, als bei meinem Onkel und vor allem bei meiner Tante zu bleiben. Meine Tante, die immer so eine nette und gütige Frau gewesen war. Die immer ein liebes Wort für mich übrig hatte und mich zum Lachen brachte, wenn es mir schlecht ging. Und doch tat ich mich in diesem Moment schwer daran, mich nicht meiner Mutter ans Bein zu schmeißen und mich an ihr festzukrallen, um sie anzuflehen mich mitzunehmen und zu lieben. Doch ich wusste, dass ein solcher Versuch durch und durch zwecklos gewesen wäre. Stattdessen umklammerte ich weiterhin das Treppengeländer und war fassungslos über die Tatsache, dass meine Mutter mich sogar noch weniger liebte, als ich geahnt hatte. So wenig sogar, dass sie bereit war mich zu verkaufen. Ich schien allerdings nicht die einzige Person zu sein, die fassungslos war über dieses Angebot, denn hinter der nur halbverschlossenen Tür regte sich nun niemand mehr und es war mucksmäuschen still. Abgesehen von ein paar Bodendielen die hier und da leise knarrten, wenn einer der Anwesenden sein Gewicht verlagerte.
„Das… das… trotz doch jeder Beschreibung! Du bist verrückt, Giselle!“, fand mein Onkel als erster zurück zu seiner Sprache. Ich konnte mir zu gut vorstellen, wie sein rundes Gesicht vor Wut rot anlief und er die zitternden Hände zu Fäusten ballte.
„So verrückt find ich das gar nicht, Schwager. Dein Bruder hat mich auf einem Haufen Schulden zurück gelassen. Das Haus gehört der Bank, sowie der Großteil des Inventars. Eine Passage nach Europa ist teuer und verzeih mir wenn ich das so sage, aber ich ziehe eine Reise in der ersten Klasse, der einer in der dritten vor. Das kannst du sicher verstehen.“ Da war er wieder. Der gewohnte kühle Tonfall, der meiner Mutter zu Eigen war. Und ich stellte mir einmal mehr die Frage, ob meine Mutter überhaupt ein Herz hatte, mit dem sie jemand anderen, außer sich selbst lieben konnte.
„DU…“, setzte mein Onkel an, doch irgendetwas hielt ihn zurück, seinen Wutausbruch weiter fortzusetzen. Nein, nicht irgendetwas, sondern irgendwer – meine Tante.
„Gib ihr das Geld, Edward“, flüsterte diese leise, aber bestimmend.
„Das kann doch nicht dein Ernst sein.“
„Doch. Gib ihr das Geld und dann soll diese… diese Person unser Haus verlassen.“
Wieder kehrte Schweigen ein und auch ich hielt die Luft an. Würde mein Onkel dem Drängen meiner Tante nachgeben und 200 Dollar bezahlen? Für mich? Ich fand die Vorstellung fürchterlich. So fürchterlich, dass mir schlecht wurde. Ich wollte nicht, dass mein Onkel Geld für mich bezahlte, damit meine Mutter mich nicht in ein Kloster steckte. Trotz meiner jungen Jahre, war ich mir darüber im Klaren, dass 200 Dollar eine Menge Geld waren. Und trotzdem wünschte sich ein kleiner egoistischer Teil in mir, dass er es trotzdem tun würde. Das ich hier bleiben konnte und endlich ein zuhause hätte, in dem man mich lieben würde.
Ich hörte die Schritte meines Onkels auf dem Paket, dann das leise Knarren einer Schranktür. Durch den kleinen Spalt konnte ich sehen, wie er irgendetwas auf dem Tisch abstellte. Wahrscheinlich die Schatulle, in der er sein Bargeld aufbewahrte. Oft hatten mein Cousin und ich uns heimlich in sein Arbeitszimmer geschlichen und mein Cousin hatte mir all die geheimen Plätze im Schrank, in der Schatulle und hinter dem großen Familiengemälde gezeigt. Es musste die Schatulle sein. Ich war mir ganz sicher. Mein Onkel zahlte Tatsächlich dafür, dass ich bleiben durfte. Wie sollte ich ihm dafür nur jemals danken?
„Da hast du das Geld.“ Abscheu machte die Stimme meines Onkels hart und ich bekam ein klein wenig Angst. „Und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich will dich hier nie wieder sehen!“
„Gut. Ich schicke morgen Mary vorbei, damit sie euch Joannas Sachen bringt. Gute Nacht.“
Die Tür zum Arbeitszimmer wurde nun ganz geöffnet und hoch erhobenen Hauptes trat die Frau heraus, die ich ein Leben lang meine Mutter genannt hatte. Die Frau, nach deren Liebe ich mich immer verzehrt hatte. Mein ganzes, kurzes Leben lang hatte ich versucht so zu sein, wie Sie und jetzt musste ich erkennen, dass ich niemals so sein würde und das auch niemals wollte. Jetzt verspürte ich nur noch Hass. Und doch erschrak ich, als meine Mutter auf ihrem Weg zur Tür kurz inne hielt und sich zu mir umdrehte, als hätte sie ganz genau gewusst, dass ich die ganze Zeit dort gesessen und alles mit angehört hatte. Wie immer sah sie auch heute perfekt aus. Obwohl mein Vater erst vor einer Woche gestorben war, trug sie kein schlichtes schwarzes Kleid, wie es sich geziemt hätte, sondern ein sehr aufwendiges dunkelrotes Kostüm, das die Kurven ihres jungen, schönen Körpers betonte. Auf dem Kopf trug sie den dazu passenden Hut, der von Feder geschmückt wurde. Ihre langen blonden Haare, um die ich sie immer so beneidet hatte waren hochgesteckt und nur ein paar Locken umrahmten ihr ebenes Gesicht, mit dem fein geschwungenen Mund, den geraden Nase und den blauen Augen. Die blauen Augen, die wohl das einzige waren, was ich mit ihr gemeinsam hatte. Um ihr rechtes Handgelenk baumelte ein passender, dunkelroter Beutel, in dem nun wohl die 200 Dollar steckten, gegen die sie mich eingetauscht hatte. Für einen kurzen Augenblick wünschte ich mir, dass die Taschendiebe über sie herfallen würden, sobald sie durch die Haustür schritt.
Doch jetzt sah sie mich an. Sie musterte mich abschätzend, von oben bis unten, bevor sie mir ein letztes Mal in die Augen sah. „Leb wohl, Joanna!“ Sie flüsterte ihren Abschiedsgruß so leise, dass ich mir bis heute nicht so ganz sicher bin, ob sie die Worte wirklich gesagt hat, oder ob ich mir das ganze lediglich eingebildet hatte. Sie nickte mir zögerlich zu und drehte sich wieder um. Der Buttler öffnete ihr die Tür und sie nickte ihm ebenfalls zu, bevor die dunkle Nacht sie verschluckte.
Und ich? Ich begann zu weinen. Ich weinte so bitterlich, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben geweint habe. Ich fühlte mich ungeliebt und verlassen. Es scheint unvorstellbar, dass ein kleines Mädchen sich so unsagbar einsam fühlen kann, aber ich tat es. Ich presste mir die Hände vor die Augen und mein kleiner Körper wurde von meinem lauten Schluchzen geschüttelt. Und dann nach einer Weile legte sich, wie aus dem Nichts eine kleine Hand um meine Schulter und zog mich sanft an einen Körper heran. Es war mein Cousin. Er hatte ebenfalls die ganze Zeit auf der Treppe gesessen, nur ein paar Stufen weiter über mir und er hatte ebenfalls alles mit angehört. Ich hatte gewusst, dass er da war. Ich hatte es die ganze Zeit gewusst und doch hatte ich nicht zu ihm hochgeschaut. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte allein sein wollen und er hatte es nicht nur verstanden, sondern auch respektiert. Doch jetzt hatte er sich nicht mehr auf seinem Platz halten können und war zu mir gekommen, um mir Trost zu spenden und ich war ihm dankbar dafür. „Ich hab solche Angst, Edward“, schluchzte ich und bettete meinen Kopf an seiner Brust.
Tröstend strichen seine Hände über meinen Rücken und meine Haare und er begann, mich sanft zu hin und her zu wiegen. „Das musst du nicht, Anni. Ich passe jetzt auf dich auf.“
„Ich nehme übermorgen den Zug nach New York und von dort aus ein Schiff nach Le Havre“, ertönte die Stimme meiner Mutter im flüssigsten Englisch, was mich ein wenig erstaunte, da sie mit mir immer nur Französisch gesprochen hat. Wenn sie überhaupt ab und zu Mal das Wort an mich richtete.
„Das kannst du nicht machen!“, herrschte mein Onkel sie an und ich brauchte nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, wie seine mächtige Faust auf die Holzplatte seines Schreibtisches donnerte. „Mein Bruder ist gerade einmal eine Woche tot. Sein Leichnam gerade erst unter der Erde und du willst schon das Land verlassen?“
„Das Eheversprechen an Ernest, das ich gezwungen wurde zu geben, war das einzige, was mich hier gehalten hat. Jetzt ist er tot und es beliebt mir zu gehen, wohin ich will.“
„Wie kannst du nur so kaltherzig sein?“ Die Stimme meiner Tante erzitterte unter einem leisen Schluchzen. „Ernest hat immer alles für dich getan. Er hat dich geliebt und geheiratet, obwohl du dich von einem anderen Mann hast schwängern lassen.“
„Einen Mann den ich geliebt habe und den man mir entrissen hat“, fauchte meine Mutter sie an und mir stockte der Atem.
Ich war vielleicht erst acht Jahre alt, aber ich war kein Dummkopf. Ich hatte die Worte, die gesprochen wurde genau verstanden und doch ergaben sie in meine Kopf keinen Sinn. Wenn meine Mutter bereits von einem anderen Mann schwanger gewesen war, als sie Ernest Masen geheiratet hat, dann bedeutete das, dass der Mann, den ich für meinen Vater gehalten hatte, den ich geliebt und verehrt hatte und der nun tot war, gar nicht mein Vater war. Ich sog laut stark die Luft in meine Lungen und fürchtete für einen kurzen Moment, dieses pure Einatmen wäre so laut gewesen, das man es im ganzen Haus hätte hören können. Doch niemand nahm Notiz von mir.
„Das kannst du einfach nicht machen, Giselle!“, ließ sich meine Tante nicht unterkriegen und erhob ihre Stimme. „Denk doch auch mal an Anni. Sie ist doch gerade erst acht und hier aufgewachsen. Sie wird Probleme haben, sich in einer neuen Umgebung, einem neuen Land, in dem man eine ganz andere Sprache spricht zurecht zu finden.“
„Mach dir um Joanna keine Sorgen. Sie wird nicht mitkommen. Ich habe für sie einen Platz im Nonnenkloster von Saint Joseph.“
„Das ist doch wohl der Gipfel der Unglaublichkeiten!“ Wider knallte die Faust meines Onkels auf den Tisch. Dieses Mal mit einer solchen Gewalt, das ich die Gegenstände, die darauf standen klirren hören konnte. „Du wirst Anni ganz sicher nicht in ein Kloster abschieben!“
In meinem Kopf breitete sich langsam ein leises Summen aus. Diese leise Melodie, die sich immer dann abspielte, wenn Dinge gesagt wurden, die ich nicht hören wollte. Zum Beispiel als man mir vor einer Woche sagt mein Vater wäre gestorben, da habe ich dieses Summen ganz deutlich gehört. Es beginnt ganz leise und wird dann langsam aber stetig immer lauter. Doch jetzt wollte ich dieses Lied nicht hören. Ich wollte hören, was gesagt wurde. Ich war völlig geschockt über den Verlauf der Dinge, doch ich musste einfach weiter zuhören. Hier ging es schließlich um mich. Hier wurden Entscheidungen über mein Leben getroffen, und niemand schien es für nötig zu halten, mich nach meiner Meinung zu fragen. Ein Kloster. Ich war einfach fassungslos. Ich habe nie verstanden, was ich ihr getan haben könnte, doch so sehr ich mich auch bemühte die Liebe meiner Mutter zu erwecken, ich erntete immer nur Distanz. Schlimmer noch. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, sie empfände meine Nähe als abstoßend und sie musste sich regelrecht zusammen reißen, um nicht zu spucken. Das ihre Abneigung gegen mich allerdings so stark war, dass sie mich in ein Kloster stecken wollte, das hatte ich noch nicht einmal ansatzweise geahnt. Das konnte sie doch nicht tun. Mit eisernem Griff umklammerte ich das Treppengeländer so stark, dass meine Fingerknöchel ganz weiß wurden. Mein Blick allerdings blieb starr auf die Tür zum Arbeitszimmer gerichtet.
„Falls ich dich mal kurz über die Gegebenheiten aufklären dürfte, Schwager. Joanna ist mein Kind und ich kann mit meinem Kind machen was ich will.“
„Du bist der herzloseste Mensch den ich kenne.“ Meine Tante, die eben noch rasend vor Wut geschrien hatte sprach nun ganz leise und heiser.
„Du weißt doch nicht wie das ist, Elisabeth!“ Die Stimme meiner Mutter nahm etwas Bedrohliches an. Ähnlich dem Geräusch, das eine Schlange macht, bevor sie zubeißt. „Jedes Mal wenn ich in das Gesicht dieses Kindes sehe, sehe ich was man mir genommen hat. Glaubst du ich bin mir nicht bewusst, dass ich aus gekränkter Eitelkeit eine schlechte Mutter bin? Glaubst du nicht, ich hätte es niemals versucht? Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht in ihr Gesicht sehen ohne an ihn zu denken. Sie wird es in einem Kloster besser haben, als bei mir.“
„Sie wird eingehen! Wenn du dieses Kind in ein Kloster steckst, wird sie eingehen“, versuchte meine Tante ein letztes Mal auf meine Mutter einzureden, doch ihre Stimme war mittlerweile so leise und von Tränen gefüllt, das man sie kaum noch hören konnte.
„Ich weiß überhaupt nicht, was du dich plötzlich so um dieses Kind scherst. Du bist doch in keinerlei Weise mit ihr verwandt.“
„Das Blut nicht immer dicker ist als Wasser, das beweist du doch nur zu gut. Bevor du Anni in ein Kloster gibst, bleibt sie bei uns!“
In meinem Kopf herrschte ein heilloses Durcheinander. Erst wollte meine Mutter mich in ein Kloster abschieben und sich selbst nach Frankreich absetzen. Dann erfuhr ich, dass der Mann, den ich so viele Jahre für meinen Vater gehalten habe gar nicht mein Vater ist und dass meine Mutter mich deshalb nicht liebt. Und nun wurde darüber verhandelt, wo ich denn nun verbleiben soll. In diesem Moment wurde ich mir das erste Mal darüber klar, warum man Gespräche anderer Leute nicht belauschen sollte. Trotzdem fiel es mir von Sekunde zu Sekunde schwerer, auf meinem Platz im Schatten sitzen zu bleiben. Zu gerne hätte ich das Arbeitszimmer gestürmt und allen meine Meinung zu diesem ganzen Thema ins Gesicht geschriene. Aber dann hätte ich mit Sicherheit großen Ärger bekommen und wahrscheinlich hätte sich auch niemand für meine Meinung - die Meinung eines Kindes – interessiert. Und dabei ging es hier doch die ganze Zeit um mich. Um mich und um mein Leben. Erste Tränen der Verzweiflung suchten sich ihren Weg aus meinen Augenwinkeln und liefen stumm über meine geröteten Wangen, die sich so heißer als Feuer anfühlten.
„Gut, wenn du das Kind unbedingt haben willst. Für 200 Dollar ist es deins.“
Die Worte meiner Mutter schienen in den Gemäuern des alten Hauses wieder zu hallen und trotzdem legte sich plötzlich eine bleierne Schwere über die bereits herrschende Nacht. Das hatte sie nicht gesagt. Nein, das konnte sie einfach nicht gesagt haben. Sie war doch meine Mutter. Verletzte Eitelkeit, verletzter Stolz, unerfüllte Liebe hin oder her. Sie war doch meine Mutter. Ich musste schluchzen und hielt mir meine zitternden Hände vor den Mund. Ich hätte mir nichts sehnlicher gewünscht, als bei meinem Onkel und vor allem bei meiner Tante zu bleiben. Meine Tante, die immer so eine nette und gütige Frau gewesen war. Die immer ein liebes Wort für mich übrig hatte und mich zum Lachen brachte, wenn es mir schlecht ging. Und doch tat ich mich in diesem Moment schwer daran, mich nicht meiner Mutter ans Bein zu schmeißen und mich an ihr festzukrallen, um sie anzuflehen mich mitzunehmen und zu lieben. Doch ich wusste, dass ein solcher Versuch durch und durch zwecklos gewesen wäre. Stattdessen umklammerte ich weiterhin das Treppengeländer und war fassungslos über die Tatsache, dass meine Mutter mich sogar noch weniger liebte, als ich geahnt hatte. So wenig sogar, dass sie bereit war mich zu verkaufen. Ich schien allerdings nicht die einzige Person zu sein, die fassungslos war über dieses Angebot, denn hinter der nur halbverschlossenen Tür regte sich nun niemand mehr und es war mucksmäuschen still. Abgesehen von ein paar Bodendielen die hier und da leise knarrten, wenn einer der Anwesenden sein Gewicht verlagerte.
„Das… das… trotz doch jeder Beschreibung! Du bist verrückt, Giselle!“, fand mein Onkel als erster zurück zu seiner Sprache. Ich konnte mir zu gut vorstellen, wie sein rundes Gesicht vor Wut rot anlief und er die zitternden Hände zu Fäusten ballte.
„So verrückt find ich das gar nicht, Schwager. Dein Bruder hat mich auf einem Haufen Schulden zurück gelassen. Das Haus gehört der Bank, sowie der Großteil des Inventars. Eine Passage nach Europa ist teuer und verzeih mir wenn ich das so sage, aber ich ziehe eine Reise in der ersten Klasse, der einer in der dritten vor. Das kannst du sicher verstehen.“ Da war er wieder. Der gewohnte kühle Tonfall, der meiner Mutter zu Eigen war. Und ich stellte mir einmal mehr die Frage, ob meine Mutter überhaupt ein Herz hatte, mit dem sie jemand anderen, außer sich selbst lieben konnte.
„DU…“, setzte mein Onkel an, doch irgendetwas hielt ihn zurück, seinen Wutausbruch weiter fortzusetzen. Nein, nicht irgendetwas, sondern irgendwer – meine Tante.
„Gib ihr das Geld, Edward“, flüsterte diese leise, aber bestimmend.
„Das kann doch nicht dein Ernst sein.“
„Doch. Gib ihr das Geld und dann soll diese… diese Person unser Haus verlassen.“
Wieder kehrte Schweigen ein und auch ich hielt die Luft an. Würde mein Onkel dem Drängen meiner Tante nachgeben und 200 Dollar bezahlen? Für mich? Ich fand die Vorstellung fürchterlich. So fürchterlich, dass mir schlecht wurde. Ich wollte nicht, dass mein Onkel Geld für mich bezahlte, damit meine Mutter mich nicht in ein Kloster steckte. Trotz meiner jungen Jahre, war ich mir darüber im Klaren, dass 200 Dollar eine Menge Geld waren. Und trotzdem wünschte sich ein kleiner egoistischer Teil in mir, dass er es trotzdem tun würde. Das ich hier bleiben konnte und endlich ein zuhause hätte, in dem man mich lieben würde.
Ich hörte die Schritte meines Onkels auf dem Paket, dann das leise Knarren einer Schranktür. Durch den kleinen Spalt konnte ich sehen, wie er irgendetwas auf dem Tisch abstellte. Wahrscheinlich die Schatulle, in der er sein Bargeld aufbewahrte. Oft hatten mein Cousin und ich uns heimlich in sein Arbeitszimmer geschlichen und mein Cousin hatte mir all die geheimen Plätze im Schrank, in der Schatulle und hinter dem großen Familiengemälde gezeigt. Es musste die Schatulle sein. Ich war mir ganz sicher. Mein Onkel zahlte Tatsächlich dafür, dass ich bleiben durfte. Wie sollte ich ihm dafür nur jemals danken?
„Da hast du das Geld.“ Abscheu machte die Stimme meines Onkels hart und ich bekam ein klein wenig Angst. „Und jetzt sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich will dich hier nie wieder sehen!“
„Gut. Ich schicke morgen Mary vorbei, damit sie euch Joannas Sachen bringt. Gute Nacht.“
Die Tür zum Arbeitszimmer wurde nun ganz geöffnet und hoch erhobenen Hauptes trat die Frau heraus, die ich ein Leben lang meine Mutter genannt hatte. Die Frau, nach deren Liebe ich mich immer verzehrt hatte. Mein ganzes, kurzes Leben lang hatte ich versucht so zu sein, wie Sie und jetzt musste ich erkennen, dass ich niemals so sein würde und das auch niemals wollte. Jetzt verspürte ich nur noch Hass. Und doch erschrak ich, als meine Mutter auf ihrem Weg zur Tür kurz inne hielt und sich zu mir umdrehte, als hätte sie ganz genau gewusst, dass ich die ganze Zeit dort gesessen und alles mit angehört hatte. Wie immer sah sie auch heute perfekt aus. Obwohl mein Vater erst vor einer Woche gestorben war, trug sie kein schlichtes schwarzes Kleid, wie es sich geziemt hätte, sondern ein sehr aufwendiges dunkelrotes Kostüm, das die Kurven ihres jungen, schönen Körpers betonte. Auf dem Kopf trug sie den dazu passenden Hut, der von Feder geschmückt wurde. Ihre langen blonden Haare, um die ich sie immer so beneidet hatte waren hochgesteckt und nur ein paar Locken umrahmten ihr ebenes Gesicht, mit dem fein geschwungenen Mund, den geraden Nase und den blauen Augen. Die blauen Augen, die wohl das einzige waren, was ich mit ihr gemeinsam hatte. Um ihr rechtes Handgelenk baumelte ein passender, dunkelroter Beutel, in dem nun wohl die 200 Dollar steckten, gegen die sie mich eingetauscht hatte. Für einen kurzen Augenblick wünschte ich mir, dass die Taschendiebe über sie herfallen würden, sobald sie durch die Haustür schritt.
Doch jetzt sah sie mich an. Sie musterte mich abschätzend, von oben bis unten, bevor sie mir ein letztes Mal in die Augen sah. „Leb wohl, Joanna!“ Sie flüsterte ihren Abschiedsgruß so leise, dass ich mir bis heute nicht so ganz sicher bin, ob sie die Worte wirklich gesagt hat, oder ob ich mir das ganze lediglich eingebildet hatte. Sie nickte mir zögerlich zu und drehte sich wieder um. Der Buttler öffnete ihr die Tür und sie nickte ihm ebenfalls zu, bevor die dunkle Nacht sie verschluckte.
Und ich? Ich begann zu weinen. Ich weinte so bitterlich, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben geweint habe. Ich fühlte mich ungeliebt und verlassen. Es scheint unvorstellbar, dass ein kleines Mädchen sich so unsagbar einsam fühlen kann, aber ich tat es. Ich presste mir die Hände vor die Augen und mein kleiner Körper wurde von meinem lauten Schluchzen geschüttelt. Und dann nach einer Weile legte sich, wie aus dem Nichts eine kleine Hand um meine Schulter und zog mich sanft an einen Körper heran. Es war mein Cousin. Er hatte ebenfalls die ganze Zeit auf der Treppe gesessen, nur ein paar Stufen weiter über mir und er hatte ebenfalls alles mit angehört. Ich hatte gewusst, dass er da war. Ich hatte es die ganze Zeit gewusst und doch hatte ich nicht zu ihm hochgeschaut. Nicht ein einziges Mal. Ich hatte allein sein wollen und er hatte es nicht nur verstanden, sondern auch respektiert. Doch jetzt hatte er sich nicht mehr auf seinem Platz halten können und war zu mir gekommen, um mir Trost zu spenden und ich war ihm dankbar dafür. „Ich hab solche Angst, Edward“, schluchzte ich und bettete meinen Kopf an seiner Brust.
Tröstend strichen seine Hände über meinen Rücken und meine Haare und er begann, mich sanft zu hin und her zu wiegen. „Das musst du nicht, Anni. Ich passe jetzt auf dich auf.“
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 3 Part 1
Rückblick
Als meine Mutter mich auf Nimmerwiedersehen verließ, war ich zutiefst betroffen, verletzt und traurig. Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich mich so einsam und verlassen gefühlt und ich gab mir selbst die Schuld dafür. Es war meine Schuld, dass sie gegangen war. Hätte ich mich nur ein wenig bemüht, ein besseres Kind zu sein, dann wäre sie vielleicht geblieben und hätte gelernt mich zu lieben. Dieses Gefühl fraß mich auf. Ich weinte jede Nacht und jeden Tag - wochenlang. Ich sprach mit Niemanden, aß kaum und verkroch mich wann immer es ging unter meiner Bettdecke. Und jedesmal war Edward da. Jedesmal wenn ich drohte, in meinen eigenen Tränen zu ertrinken schloss er mich in seine Arme und versuchte mich zu trösten.
Und schließlich kam der Tag an dem meine Verzweiflung einer grenzenlosen Wut Platz machte. Ich war wütend. Wütend auf meine Mutter, wütend auf Gott, wütend auf alle Menschen um mich herum, weil mein Leben nicht seinen normalen Gang ging. Weil meine Mutter einfach weggegangen war ohne sich auch nur die Mühe zu machen, ein Leben mit mir zu versuchen. Ich war wütend auf meinen Onkel und auf meine Tante, weil diese immer versuchten mich zu beruhigen und nur das Beste für mich wollte. Und ich war wütend auf die anderen Kinder, die hinter meinem Rücken über mich lachten und mit dem Finger auf mich zeigten. Nur auf Edward war ich nie wütend, denn er ließ mich gewähren. Obwohl er mehr als ein halbes Jahr jünger war als ich, benahm er sich wie ein großer Bruder. Er ließ mich schreien und zetern, weinen und schimpfen und nahm es mit jedem auf, der auch nur ein schlechtes Wort über mich sagte. Er hat sich mehr als einmal wegen mir geprügelt, denn er hatte es mir versprochen. Er hatte versprochen, dass er auf mich aufpassen würde.
Meine neue „Familie“ hatte während all dieser Zeit, in der ich eine Talfahrt der Gefühle nach der anderen vollzog vor allem eins: Geduld. Auch wenn meine Tante mehrfach den Versuch unternahm mich auf den Weg des Lebens zurückzuführen, so zwang sie mich doch zu nichts. Niemand schimpfte mit mir, wenn ich mal wieder einen ausgewachsenen Wutanfall über irgendeine Kleinigkeit bekam und niemand maßregelte mich, wenn ich nicht zu Tisch erschien. Meine Tante, mein Onkel und natürlich Edward, sie alle hatten Verständnis für das was ich durchmachte. Und nach und nach legte sich auch mein Zorn. Fast hätte ich es selbst kaum gemerkt, doch mit der Zeit gewöhnte ich mich immer mehr an die neue Situation. Immer öfter gelang es mir nun wieder zu lachen und ich nahm meinen Platz als Tochter der Familie ein. Meine Wut wurde zu Dankbarkeit. Es war eine komische Wandlung doch auf einmal zog eine Art Frieden in mein Innerstes ein. Eine Ruhe, die ich so noch nie gekannt hatte. Das Gefühl von Sicherheit. Die Gewissheit geliebt zu werden. Es fühlte sich gut an. Ab und zu ertappte ich mich sogar dabei, wie ich meine Tante in einem Augenblick des puren Wohlgefallens „Mama“ nannte. Es war ein Wunsch, genau wie es die Wahrheit war. Sie war die Mutter die ich mir immer gewünscht hatte und in gewisser Weise war ich auch die Tochter, nach der sie sich immer gesehnt hatte. Ich hatte endlich einen Platz in diesem Leben gefunden und meinem Glück stand nun nichts mehr im Wege.
Wenn man einmal davon absah, dass die Menschen die sich wie meine Eltern benahmen eigentlich mein Onkel und meine Tante war und der Junge, der sich wie mein großer Bruder aufführte eigentlich mein kleiner Cousin, dann verlief mein Leben von jenem schicksalhaften Abend ganz normal, um nicht zu sagen langweilig. Ich besuchte Misses Campells Schule für junge Damen, wo man mich zu einer verantwortungsbewussten, jungen Frau mit perfekten Manieren heranzog. Und meine Freizeit vertrieb ich mir mit Teegesellschaften, Handarbeiten und natürlichem dem Kirchgang. Doch am liebsten war ich allein mit meinen Büchern. Im Großen und Ganzen ödete mein Leben mich schon ein wenig an, aber ich war es meinem Onkel und meiner Tante einfach schuldig ihren Wünschen nachzukommen und ihnen keine Schande zu bereiten. Mein Weg war mehr oder minder voraus bestimmt. Mit 18 würde man mich auf eine Universität schicken, damit ich mich in Kunst und Literatur bilden könnte und dann würde mein Onkel mir einen Gatten suchen, dem ich fortan eine gute Ehefrau sein würde. Das war ihr Wunsch und ich fügte mich.
Zumindest hatte ich den guten Willen mich zu fügen, denn ich hätte es wahrlich schlimmer treffen können. Doch all meine guten Absichten schwanden an jenem schicksalhaften Tag, an dem ich zur Geburtstagsfeier unserer Nachbarin Mary Sommer geladen war. Die Sommers´waren noch nicht lange unsere Nachbarn, doch Marys Vater schon seit Jahren ein Kollege meines Onkels und so war es nur naheliegend, das Mary und ich uns schnell angefreundet hatten. Eigentlich war ein Geburtstag keine besondere Angelegenheit. Ein paar Mädchen trafen sich, tranken Tee, aßen Gebäck, überreichten Geschenke und amüsierten sich über den neuesten Klatsch und Tratsch. Ich genoss die Gesellschaft meiner Freundinnen und lauschte gespannt den Erzählungen von Sophie Hall über die jüngsten Verfehlungen ihres Dienstmädchens, als ein junger Mann in Uniform den Salon betrat. „Ladys!“ Er lächelte spitzbübisch, während er eine Hand auf seine Brust legte und sich übertrieben höfflich verneigte. Sofort waren die Blicke aller Anwesenden auf ihn gerichtet. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen und meinen Freundinnen schien es kaum anders zu gehen. „Ich entschuldige mich für diese unhöfliche Störung, aber wenn es ihnen nichts aus macht, würde ich meine Schwester gerne für einen Moment entführen.“ Er nickte in Marys Richtung, die nun endlich aus ihrer überraschten Erstarrung erwachte. Wie von einer Hummel gestochen sprang sie von ihrem Stuhl auf, wobei sie einen spitzen Schrei ausstieß, dann fiel sie dem Unbekannten um den Hals.
„Thomas! Oh Thomas! Was tust du hier? Wie lange bleibst du?“, bestürmte sie ihren Bruder sogleich mit Fragen. Thomas lachte ein angenehmes Lachen, das mir in den Ohren dröhnte und mein Blut in Wallung brachte. Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich so etwas verspürt, wie in diesem Moment. Ich war nicht dazu in der Lage meinen Blick von ihm zu lösen, obwohl ich mir vollstens darüber im Klaren war, dass mein Gestarre äußerst unhöflich war. Thomas Sommer war ein groß gewachsener junger Mann von circa zwanzig Jahren, mit dunklem Haar und braunen Augen, die schelmisch blitzten und mich in ihren Bann zogen. Ein Kribbeln breitete sich langsam in meinem ganzen Körper aus und für eine kurze Sekunde beneidete ich Mary darum, dass sie ihm einfach so ungeniert um den Hals fallen konnte.
„Welch unfeines Betragen, Mary“, rügte der Bruder seine jüngere Schwester, doch es war ihm deutlich anzusehen, dass er sie nur ärgern wollte. „So benimmt man sich doch wirklich nicht vor seinen Gästen. Wenn du mir aber trotzdem einen Moment deiner ungeteilten Aufmerksamkeit schenken würdest, bin ich gerne bereit deine Fragen zu beantworten.“ Mit diesen Worten reichte er Mary seinen Arm und führte sie hinaus. Selbst als die Tür bereits hinter den beiden ins Schloss gefallen war und die Unterhaltung zu neuem Leben erwachte, starte ich den beiden noch hinterher. Erst als Beth Monroe mir einen schmerzhaften Rippenstoß verpasste, schaffte ich es mich wieder zu sammeln.
„Er ist 20 Jahre alt und dient bei der royal Army in England im Kampf gegen die Deutschen“, erklärte Sophie gerade und errang damit wieder meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich wollte alles über diesen Mann wissen. „Er war seit drei Jahren nicht mehr in Amerika. Ich frag mich, wieso er jetzt hergekommen ist“, schloss sie weiter.
„Vielleicht hat er Urlaub“, schlug Beth vor.
„Oder er will sich vermählen“, vermutete Georgia und verpasste mir damit einen Dolchstoß ins Herz.
In den nächsten Tagen befand ich mich in einem fast schon tranceartigen Zustand und ein jeder meiner Gedanken galt Thomas Sommer. Ich wusste, dass meine Schwärmerei töricht war. Ich kannte diesen Mann nicht. Hatte ihn nur einmal gesehen. Und selbst wenn ich ihn gekannt hätte, so war er fast fünf Jahre älter als ich und ihm würde wohl kaum der Sinn danach stehen seine Zeit mit einer dummen, kleinen Gans wie mir zu verbringen. Trotzdem malte meine Fantasie sich aus wie es wäre, wenn wir zusammen wären. Manchmal gingen meine Gedanken dabei sogar soweit, dass ich errötete.
„Anni!“, brüllte mich Edward fast schon an, als ich mal wieder in einen meinen Tagträume versunken war. Verwundert ließ ich das Buch sinken, in dem ich ohnehin nicht gelesen hatte und sah ihn an. „Mum hat gesagt wir sollen zum Markt gehen und ein paar Sachen besorgen. Wir kriegen heute Abend Besuch und Sidonie ist in der Küche unabkömmlich.“
Genervt verzog ich die Mundwinkel. Eigentlich ging ich gerne auf den Markt, doch in den letzten Tagen hatte es immer wieder geschneit und es war bitter kalt. Man tat gut daran, sich drinnen aufzuhalten. Trotzdem widersprach ich nicht. Seufzend holte ich meinen Mantel. Zeitgleich griff ich nach dem großen Weidenkorb, der bereits in der Halle stand und versuchte mir einhändig einen Schal um den Hals zu schlingen, dann folgte ich meinem Cousin nach draußen. Obwohl es bereits Februar war, hatte der Winter noch einmal richtig zugeschlagen und ich begann augenblicklich zu frösteln. Im Schlendertempo gingen Edward und ich nebeneinander her und plauderten über dieses und jenes, bis er eine Ansammlung von Menschen auf der anderen Straßenseite entdecke. Mehrere große Wagen standen in einem Halbkreis, gesäumt von jungen Soldaten, die Rekruten für die Army zu werben schienen. Sofort war Edward Feuer und Flamme. „Ich bin gleich wieder da“, sagte er kurz angebunden und sprintete über die Straße.
„Edward!“, schrie ich ihm hinterher, doch er schien mich gar nicht wahr zu nehmen. Mein Cousin war aus irgendeinem, mir unerfindlichen Grunde völlig fasziniert vom Krieg und er machte kein Geheimnis daraus, dass er gerne Soldat werden würde. Wütend stemmte ich die Hände in die Hüften und schnaubte, aber er war längst in dem Menschenknäul verschwunden. Gerade als ich einen Fuß auf die Straße setzen wollte um ihm zu folgen, setzte sich eines der monströsen Autos, laut hupend in Bewegung. Erschrocken wich ich zurück und trat auf eine gefrorene Pfütze, auf der mein Fuß wegrutschte. Wild ruderte ich mit den Armen, um den drohenden Sturz zu verhindern, doch es schien zwecklos. Ergeben schlossen sich meine Augen fast wie von selbst, als würde der Sturz weniger schmerzhaft, wenn ich es nicht mit ansehen musste. Doch ich fiel nicht. Stattdessen fasste mich eine Hand am Oberarm und hielt mich fest bis meine Füße aufhörten zu schlittern und ich mein Gleichgewicht widererlangt hatte.
„Na da ist ja gerade noch einmal gut gegangen“, sagte eine angenehme, tiefe Bassstimme, die mir seltsam bekannt vorkam und als ich meine Augen endlich wieder öffnete, sah ich in das schöne Gesicht von dem ich so oft geträumt hatte. Für einen kurzen Moment begann ich mich zu fragen, ob ich vielleicht doch gestürzt war und mir so stark den Kopf angeschlagen hatte, dass ich halluzinierte. Doch wenn ich bewusstlos wäre, dann wäre mir nicht immer noch so kalt und mein Atem würde keine weißen Wölkchen bilden. Nein, ich war bei vollem Bewusstsein und vor mir stand Thomas Sommer wie der edle Rotter der die holde Dame gerettet hatte, nur das er anstatt einer Rüstung eine Uniform trug.
„Ich… äh… oh… Danke“, stammelte ich unbeholfen vor mich hin und ich spürte wie meine Wangen heiß wurden vor Scharm.
„Nichts zu danken. Ich hätte es mir niemals verzeihen können, wenn ein so schönes Wesen wie Sie Schaden genommen hätte, Miss…?“ Fragend sah er mich an und ich konnte ein Kichern nur schwerlich unterdrücken, aufgrund seiner liebenswerten Süßholzraspelei.
„Masen. Joanna Masen“, berief ich mich aber schließlich auf meine guten Umgangsformen und strafte die Schultern, bevor ich ihm die Hand reichte.
„Es ist mir eine Ehre, Miss Masen. Ich bin Thomas Sommer.“ Fest und zugleich zärtlich nahm er meine Hand und drückte sie. Mein Herz setzte einen Moment zu schlagen aus, bevor es seine Tätigkeit mit doppelter Geschwindigkeit wieder aufnahm. „Verzeiht mir, wenn ich unhöflich bin, aber kann es sein, dass wir uns bereits einmal begegnet sind?“
„Auf dem Geburtstag ihrer Schwester“, stimmte ich zu und erwiderte sein Lächeln.
„Ach ja richtig, ich erinnere mich.“ Er drückte meine Hand noch einmal und ließ sie dann los. Obwohl ich wusste, dass er sie bereits länger gehalten hatte als es sich gehörte, war ich doch ein wenig enttäuscht. „Und dürfte ich fragen, wieso Sie ganz allein durch die vereisten Straßen irren.“
„Ich irre nicht, ich weiß genau wo ich bin und wo ich hin will. Und allein bin ich auch nicht“, korrigierte ich ihn forsch und biss mir im selben Moment auf die Unterlippe obgleich dieser ungestümen Aussage. Thomas lachte leise und legte den Kopf schief. Für einen Moment sah er mich an, als zweifle er an meinen Verstand. „Ich bin mit meinem Cousin auf dem Weg zum Markt. Er ist…“ Weiter kam ich nicht, weil Edward im selben Moment angerannt kam.
„Da bin ich wieder“, teilte er das Offensichtliche mit. „Oh. Hallo Thomas.“ Freundschaftlich schüttelten sich mein Cousin und der Soldat die Hände.
„Hallo Edward“, erwiderte Thomas den Gruß. „Ich habe mich gerade mit deiner liebreizenden Cousine bekannt gemacht. Wie kommt es, dass sie man sie zuvor noch nie gesehen hat?“ Ich lächelte schief, als Edward mich argwöhnisch ansah und sich dann mit einem Schulterzucken wieder an Thomas wandte.
„Weil sie ihre Nase lieber in Bücher steckt und sich der Öffentlichkeit nicht öfter als nötig zeigt.“ Meine Augen weiteten sich vor Schreck über seine Aussage und ich warf Edward einen zornigen Blick zu.
„Ach so.“ Wieder lachte Thomas und ich fühlte mich unbehaglich.
„Und wir müssen jetzt auch weiter“, richtete ich das Wort deshalb an Edward, bevor dieser noch mehr Ungeheuerlichkeiten über mich erzählen konnte und riss ihn rüde am Arm. „Danke nochmal für ihre Hilfe, Thomas. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“
„Ebenso, Miss Masen. Tschüss Edward.“ Der Soldat tippte sich zum Abschied kurz an den Hut während ich versuchte meinen Cousin in Bewegung zu setzen. Dieser gab schließlich nach und ließ sich von mir mitziehen.
„Bis heute Abend, Thomas!“, rief er noch über die Schulter, bevor wir um eine Ecke verschwanden.
Wütend stieß ich die Luft aus meinen Lungen und ließ Edward los, um mich vor ihm aufzubauen. „Wieso erzählst du ihm, dass ich mich hinter meinen Büchern verstecke?“
„Weil es die Wahrheit ist.“ Edward grinste und schlängelte sich an mir vorbei. Ich ballte kurz die Fäuste, dann folgte ich ihm.
„Der glaubt doch jetzt ich wäre ein Mauerblümchen, dass das Haus nicht verlässt.“
„Ja und? Soll er doch denken was er will. Was stört dich das?“
„Was mich das stört?“, empörte ich mich, brach dann allerdings ab. Ich konnte Edward ja schließlich schlecht gestehen, dass ich mich Hals über Kopf in den mir völlig Unbekannten verliebt hatte. „Was soll das überhaupt heißen ‚Bis heute Abend‘?“, wechselte ich deshalb hastig das Thema.
„Das soll heißen, dass die Sommers´ heute Abend bei uns zum Dinner geladen sind. Außerdem glaube ich, dass du dich in Thomas verknallt hast, Cousinchen.“ Mit einem frechen Grinsen auf dem Gesicht sah Edward mich an, dann beschleunigte er seinen Schritt so, dass ich nicht mehr mit ihm mithalten konnte.
„Du bist unmöglich!“, brüllte ich hinter ihm her und sprach den Rest des Tages kein Wort mehr mit ihm.
Und schließlich kam der Tag an dem meine Verzweiflung einer grenzenlosen Wut Platz machte. Ich war wütend. Wütend auf meine Mutter, wütend auf Gott, wütend auf alle Menschen um mich herum, weil mein Leben nicht seinen normalen Gang ging. Weil meine Mutter einfach weggegangen war ohne sich auch nur die Mühe zu machen, ein Leben mit mir zu versuchen. Ich war wütend auf meinen Onkel und auf meine Tante, weil diese immer versuchten mich zu beruhigen und nur das Beste für mich wollte. Und ich war wütend auf die anderen Kinder, die hinter meinem Rücken über mich lachten und mit dem Finger auf mich zeigten. Nur auf Edward war ich nie wütend, denn er ließ mich gewähren. Obwohl er mehr als ein halbes Jahr jünger war als ich, benahm er sich wie ein großer Bruder. Er ließ mich schreien und zetern, weinen und schimpfen und nahm es mit jedem auf, der auch nur ein schlechtes Wort über mich sagte. Er hat sich mehr als einmal wegen mir geprügelt, denn er hatte es mir versprochen. Er hatte versprochen, dass er auf mich aufpassen würde.
Meine neue „Familie“ hatte während all dieser Zeit, in der ich eine Talfahrt der Gefühle nach der anderen vollzog vor allem eins: Geduld. Auch wenn meine Tante mehrfach den Versuch unternahm mich auf den Weg des Lebens zurückzuführen, so zwang sie mich doch zu nichts. Niemand schimpfte mit mir, wenn ich mal wieder einen ausgewachsenen Wutanfall über irgendeine Kleinigkeit bekam und niemand maßregelte mich, wenn ich nicht zu Tisch erschien. Meine Tante, mein Onkel und natürlich Edward, sie alle hatten Verständnis für das was ich durchmachte. Und nach und nach legte sich auch mein Zorn. Fast hätte ich es selbst kaum gemerkt, doch mit der Zeit gewöhnte ich mich immer mehr an die neue Situation. Immer öfter gelang es mir nun wieder zu lachen und ich nahm meinen Platz als Tochter der Familie ein. Meine Wut wurde zu Dankbarkeit. Es war eine komische Wandlung doch auf einmal zog eine Art Frieden in mein Innerstes ein. Eine Ruhe, die ich so noch nie gekannt hatte. Das Gefühl von Sicherheit. Die Gewissheit geliebt zu werden. Es fühlte sich gut an. Ab und zu ertappte ich mich sogar dabei, wie ich meine Tante in einem Augenblick des puren Wohlgefallens „Mama“ nannte. Es war ein Wunsch, genau wie es die Wahrheit war. Sie war die Mutter die ich mir immer gewünscht hatte und in gewisser Weise war ich auch die Tochter, nach der sie sich immer gesehnt hatte. Ich hatte endlich einen Platz in diesem Leben gefunden und meinem Glück stand nun nichts mehr im Wege.
Wenn man einmal davon absah, dass die Menschen die sich wie meine Eltern benahmen eigentlich mein Onkel und meine Tante war und der Junge, der sich wie mein großer Bruder aufführte eigentlich mein kleiner Cousin, dann verlief mein Leben von jenem schicksalhaften Abend ganz normal, um nicht zu sagen langweilig. Ich besuchte Misses Campells Schule für junge Damen, wo man mich zu einer verantwortungsbewussten, jungen Frau mit perfekten Manieren heranzog. Und meine Freizeit vertrieb ich mir mit Teegesellschaften, Handarbeiten und natürlichem dem Kirchgang. Doch am liebsten war ich allein mit meinen Büchern. Im Großen und Ganzen ödete mein Leben mich schon ein wenig an, aber ich war es meinem Onkel und meiner Tante einfach schuldig ihren Wünschen nachzukommen und ihnen keine Schande zu bereiten. Mein Weg war mehr oder minder voraus bestimmt. Mit 18 würde man mich auf eine Universität schicken, damit ich mich in Kunst und Literatur bilden könnte und dann würde mein Onkel mir einen Gatten suchen, dem ich fortan eine gute Ehefrau sein würde. Das war ihr Wunsch und ich fügte mich.
Zumindest hatte ich den guten Willen mich zu fügen, denn ich hätte es wahrlich schlimmer treffen können. Doch all meine guten Absichten schwanden an jenem schicksalhaften Tag, an dem ich zur Geburtstagsfeier unserer Nachbarin Mary Sommer geladen war. Die Sommers´waren noch nicht lange unsere Nachbarn, doch Marys Vater schon seit Jahren ein Kollege meines Onkels und so war es nur naheliegend, das Mary und ich uns schnell angefreundet hatten. Eigentlich war ein Geburtstag keine besondere Angelegenheit. Ein paar Mädchen trafen sich, tranken Tee, aßen Gebäck, überreichten Geschenke und amüsierten sich über den neuesten Klatsch und Tratsch. Ich genoss die Gesellschaft meiner Freundinnen und lauschte gespannt den Erzählungen von Sophie Hall über die jüngsten Verfehlungen ihres Dienstmädchens, als ein junger Mann in Uniform den Salon betrat. „Ladys!“ Er lächelte spitzbübisch, während er eine Hand auf seine Brust legte und sich übertrieben höfflich verneigte. Sofort waren die Blicke aller Anwesenden auf ihn gerichtet. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen und meinen Freundinnen schien es kaum anders zu gehen. „Ich entschuldige mich für diese unhöfliche Störung, aber wenn es ihnen nichts aus macht, würde ich meine Schwester gerne für einen Moment entführen.“ Er nickte in Marys Richtung, die nun endlich aus ihrer überraschten Erstarrung erwachte. Wie von einer Hummel gestochen sprang sie von ihrem Stuhl auf, wobei sie einen spitzen Schrei ausstieß, dann fiel sie dem Unbekannten um den Hals.
„Thomas! Oh Thomas! Was tust du hier? Wie lange bleibst du?“, bestürmte sie ihren Bruder sogleich mit Fragen. Thomas lachte ein angenehmes Lachen, das mir in den Ohren dröhnte und mein Blut in Wallung brachte. Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich so etwas verspürt, wie in diesem Moment. Ich war nicht dazu in der Lage meinen Blick von ihm zu lösen, obwohl ich mir vollstens darüber im Klaren war, dass mein Gestarre äußerst unhöflich war. Thomas Sommer war ein groß gewachsener junger Mann von circa zwanzig Jahren, mit dunklem Haar und braunen Augen, die schelmisch blitzten und mich in ihren Bann zogen. Ein Kribbeln breitete sich langsam in meinem ganzen Körper aus und für eine kurze Sekunde beneidete ich Mary darum, dass sie ihm einfach so ungeniert um den Hals fallen konnte.
„Welch unfeines Betragen, Mary“, rügte der Bruder seine jüngere Schwester, doch es war ihm deutlich anzusehen, dass er sie nur ärgern wollte. „So benimmt man sich doch wirklich nicht vor seinen Gästen. Wenn du mir aber trotzdem einen Moment deiner ungeteilten Aufmerksamkeit schenken würdest, bin ich gerne bereit deine Fragen zu beantworten.“ Mit diesen Worten reichte er Mary seinen Arm und führte sie hinaus. Selbst als die Tür bereits hinter den beiden ins Schloss gefallen war und die Unterhaltung zu neuem Leben erwachte, starte ich den beiden noch hinterher. Erst als Beth Monroe mir einen schmerzhaften Rippenstoß verpasste, schaffte ich es mich wieder zu sammeln.
„Er ist 20 Jahre alt und dient bei der royal Army in England im Kampf gegen die Deutschen“, erklärte Sophie gerade und errang damit wieder meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich wollte alles über diesen Mann wissen. „Er war seit drei Jahren nicht mehr in Amerika. Ich frag mich, wieso er jetzt hergekommen ist“, schloss sie weiter.
„Vielleicht hat er Urlaub“, schlug Beth vor.
„Oder er will sich vermählen“, vermutete Georgia und verpasste mir damit einen Dolchstoß ins Herz.
In den nächsten Tagen befand ich mich in einem fast schon tranceartigen Zustand und ein jeder meiner Gedanken galt Thomas Sommer. Ich wusste, dass meine Schwärmerei töricht war. Ich kannte diesen Mann nicht. Hatte ihn nur einmal gesehen. Und selbst wenn ich ihn gekannt hätte, so war er fast fünf Jahre älter als ich und ihm würde wohl kaum der Sinn danach stehen seine Zeit mit einer dummen, kleinen Gans wie mir zu verbringen. Trotzdem malte meine Fantasie sich aus wie es wäre, wenn wir zusammen wären. Manchmal gingen meine Gedanken dabei sogar soweit, dass ich errötete.
„Anni!“, brüllte mich Edward fast schon an, als ich mal wieder in einen meinen Tagträume versunken war. Verwundert ließ ich das Buch sinken, in dem ich ohnehin nicht gelesen hatte und sah ihn an. „Mum hat gesagt wir sollen zum Markt gehen und ein paar Sachen besorgen. Wir kriegen heute Abend Besuch und Sidonie ist in der Küche unabkömmlich.“
Genervt verzog ich die Mundwinkel. Eigentlich ging ich gerne auf den Markt, doch in den letzten Tagen hatte es immer wieder geschneit und es war bitter kalt. Man tat gut daran, sich drinnen aufzuhalten. Trotzdem widersprach ich nicht. Seufzend holte ich meinen Mantel. Zeitgleich griff ich nach dem großen Weidenkorb, der bereits in der Halle stand und versuchte mir einhändig einen Schal um den Hals zu schlingen, dann folgte ich meinem Cousin nach draußen. Obwohl es bereits Februar war, hatte der Winter noch einmal richtig zugeschlagen und ich begann augenblicklich zu frösteln. Im Schlendertempo gingen Edward und ich nebeneinander her und plauderten über dieses und jenes, bis er eine Ansammlung von Menschen auf der anderen Straßenseite entdecke. Mehrere große Wagen standen in einem Halbkreis, gesäumt von jungen Soldaten, die Rekruten für die Army zu werben schienen. Sofort war Edward Feuer und Flamme. „Ich bin gleich wieder da“, sagte er kurz angebunden und sprintete über die Straße.
„Edward!“, schrie ich ihm hinterher, doch er schien mich gar nicht wahr zu nehmen. Mein Cousin war aus irgendeinem, mir unerfindlichen Grunde völlig fasziniert vom Krieg und er machte kein Geheimnis daraus, dass er gerne Soldat werden würde. Wütend stemmte ich die Hände in die Hüften und schnaubte, aber er war längst in dem Menschenknäul verschwunden. Gerade als ich einen Fuß auf die Straße setzen wollte um ihm zu folgen, setzte sich eines der monströsen Autos, laut hupend in Bewegung. Erschrocken wich ich zurück und trat auf eine gefrorene Pfütze, auf der mein Fuß wegrutschte. Wild ruderte ich mit den Armen, um den drohenden Sturz zu verhindern, doch es schien zwecklos. Ergeben schlossen sich meine Augen fast wie von selbst, als würde der Sturz weniger schmerzhaft, wenn ich es nicht mit ansehen musste. Doch ich fiel nicht. Stattdessen fasste mich eine Hand am Oberarm und hielt mich fest bis meine Füße aufhörten zu schlittern und ich mein Gleichgewicht widererlangt hatte.
„Na da ist ja gerade noch einmal gut gegangen“, sagte eine angenehme, tiefe Bassstimme, die mir seltsam bekannt vorkam und als ich meine Augen endlich wieder öffnete, sah ich in das schöne Gesicht von dem ich so oft geträumt hatte. Für einen kurzen Moment begann ich mich zu fragen, ob ich vielleicht doch gestürzt war und mir so stark den Kopf angeschlagen hatte, dass ich halluzinierte. Doch wenn ich bewusstlos wäre, dann wäre mir nicht immer noch so kalt und mein Atem würde keine weißen Wölkchen bilden. Nein, ich war bei vollem Bewusstsein und vor mir stand Thomas Sommer wie der edle Rotter der die holde Dame gerettet hatte, nur das er anstatt einer Rüstung eine Uniform trug.
„Ich… äh… oh… Danke“, stammelte ich unbeholfen vor mich hin und ich spürte wie meine Wangen heiß wurden vor Scharm.
„Nichts zu danken. Ich hätte es mir niemals verzeihen können, wenn ein so schönes Wesen wie Sie Schaden genommen hätte, Miss…?“ Fragend sah er mich an und ich konnte ein Kichern nur schwerlich unterdrücken, aufgrund seiner liebenswerten Süßholzraspelei.
„Masen. Joanna Masen“, berief ich mich aber schließlich auf meine guten Umgangsformen und strafte die Schultern, bevor ich ihm die Hand reichte.
„Es ist mir eine Ehre, Miss Masen. Ich bin Thomas Sommer.“ Fest und zugleich zärtlich nahm er meine Hand und drückte sie. Mein Herz setzte einen Moment zu schlagen aus, bevor es seine Tätigkeit mit doppelter Geschwindigkeit wieder aufnahm. „Verzeiht mir, wenn ich unhöflich bin, aber kann es sein, dass wir uns bereits einmal begegnet sind?“
„Auf dem Geburtstag ihrer Schwester“, stimmte ich zu und erwiderte sein Lächeln.
„Ach ja richtig, ich erinnere mich.“ Er drückte meine Hand noch einmal und ließ sie dann los. Obwohl ich wusste, dass er sie bereits länger gehalten hatte als es sich gehörte, war ich doch ein wenig enttäuscht. „Und dürfte ich fragen, wieso Sie ganz allein durch die vereisten Straßen irren.“
„Ich irre nicht, ich weiß genau wo ich bin und wo ich hin will. Und allein bin ich auch nicht“, korrigierte ich ihn forsch und biss mir im selben Moment auf die Unterlippe obgleich dieser ungestümen Aussage. Thomas lachte leise und legte den Kopf schief. Für einen Moment sah er mich an, als zweifle er an meinen Verstand. „Ich bin mit meinem Cousin auf dem Weg zum Markt. Er ist…“ Weiter kam ich nicht, weil Edward im selben Moment angerannt kam.
„Da bin ich wieder“, teilte er das Offensichtliche mit. „Oh. Hallo Thomas.“ Freundschaftlich schüttelten sich mein Cousin und der Soldat die Hände.
„Hallo Edward“, erwiderte Thomas den Gruß. „Ich habe mich gerade mit deiner liebreizenden Cousine bekannt gemacht. Wie kommt es, dass sie man sie zuvor noch nie gesehen hat?“ Ich lächelte schief, als Edward mich argwöhnisch ansah und sich dann mit einem Schulterzucken wieder an Thomas wandte.
„Weil sie ihre Nase lieber in Bücher steckt und sich der Öffentlichkeit nicht öfter als nötig zeigt.“ Meine Augen weiteten sich vor Schreck über seine Aussage und ich warf Edward einen zornigen Blick zu.
„Ach so.“ Wieder lachte Thomas und ich fühlte mich unbehaglich.
„Und wir müssen jetzt auch weiter“, richtete ich das Wort deshalb an Edward, bevor dieser noch mehr Ungeheuerlichkeiten über mich erzählen konnte und riss ihn rüde am Arm. „Danke nochmal für ihre Hilfe, Thomas. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.“
„Ebenso, Miss Masen. Tschüss Edward.“ Der Soldat tippte sich zum Abschied kurz an den Hut während ich versuchte meinen Cousin in Bewegung zu setzen. Dieser gab schließlich nach und ließ sich von mir mitziehen.
„Bis heute Abend, Thomas!“, rief er noch über die Schulter, bevor wir um eine Ecke verschwanden.
Wütend stieß ich die Luft aus meinen Lungen und ließ Edward los, um mich vor ihm aufzubauen. „Wieso erzählst du ihm, dass ich mich hinter meinen Büchern verstecke?“
„Weil es die Wahrheit ist.“ Edward grinste und schlängelte sich an mir vorbei. Ich ballte kurz die Fäuste, dann folgte ich ihm.
„Der glaubt doch jetzt ich wäre ein Mauerblümchen, dass das Haus nicht verlässt.“
„Ja und? Soll er doch denken was er will. Was stört dich das?“
„Was mich das stört?“, empörte ich mich, brach dann allerdings ab. Ich konnte Edward ja schließlich schlecht gestehen, dass ich mich Hals über Kopf in den mir völlig Unbekannten verliebt hatte. „Was soll das überhaupt heißen ‚Bis heute Abend‘?“, wechselte ich deshalb hastig das Thema.
„Das soll heißen, dass die Sommers´ heute Abend bei uns zum Dinner geladen sind. Außerdem glaube ich, dass du dich in Thomas verknallt hast, Cousinchen.“ Mit einem frechen Grinsen auf dem Gesicht sah Edward mich an, dann beschleunigte er seinen Schritt so, dass ich nicht mehr mit ihm mithalten konnte.
„Du bist unmöglich!“, brüllte ich hinter ihm her und sprach den Rest des Tages kein Wort mehr mit ihm.
Zuletzt von Blossom am So 15 März 2009, 04:11 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 3 Part 2
Rückblick
Aber Edward hatte Recht gehabt. Meine Tante hatte die Sommers´ tatsächlich zum Dinner eingeladen und so verbrachte ich den Rest des Nachmittages mit flatterndem Herzen und rasendem Puls. Ich zog eines meiner besten Kleider an und kniff mir so lange in die Wangen, bis diese rosig waren. Ich wollte gut aussehen und begehrenswert. Ich wollte, dass Thomas mich attraktiv fand. Am Ende war ich so aufgeregt, dass ich noch nicht einmal Mary gegenüber ein vernünftiges Wort zustande brachte und fast das ganze Essen über schwieg. Ich hielt meinen Kopf über meinen Teller gesenkt und stocherte lediglich in meinem Essen herum, da ich nicht hungrig war. Auch den Tischgesprächen konnte ich kaum folgen und zuckte merklich zusammen, als ich plötzlich angesprochen wurde.
„Edward sagt Sie verbringen eure Zeit gerne mit Büchern, Joanna. Dürfte ich fragen, was Sie momentan lesen?“ Erwartungsvoll sah Thomas mich an und ich errötete.
„Die Ilias“, murmelte ich und errötete heftig. Schnell senkte ich meinen Blick wieder und schob mit meiner Gabel ein paar Bohnen von links nach rechts.
„Die Ilias.“ Anerkennung schwang in seiner Stimme. „Wahrlich keine leichte Lyrik.“
„Ja, unsere Joanna ist sehr belesen und sehr wissbegierig“, stimmte nun auch meine Tante mit ein und strich mir kurz über die Schulter. „Ich im Übrigen auch. Wie kommt es, dass du hier bist, Thomas? Wir haben dich ja wirklich lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Neigt sich der Krieg in Europa etwa dem Ende.“
„Ich fürchte, das Gegenteil ist der Fall, Ma‘am.“ Thomas seufzte. „Es sieht eher so aus, als könnten sich auch die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr lange aus diesem Krieg heraus halten. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Dieser Krieg wird in Europa bleiben und wird ohnehin hauptsächlich zur See ausgetragen. Ich bin hergekommen um neue Rekruten anzuwerben und kann gleichzeitig etwas Zeit mit meiner Familie verbringen.“
„Dann bleibst du also länger?“, hackte mein Onkel nach und Thomas nickte. Dann erzählte er vom Krieg und ich nutzte die Gelegenheit ihn anzusehen ohne unhöflich zu sein und tat so als würde ich zuhören, obwohl seine Worte fast ungehört an mir vorbei zogen. Edward hingegen lauschte seinen Erzählungen mit unverhohlenem Eifer. Auf unterschiedliche Art und Weise verehrten wir den jungen Mann wohl beide, nur das Edward keinen Hehl daraus machte.
Der Abend endete ohne, dass ich es geschafft hätte ein vernünftiges Wort herauszubringen und ich ärgerte mich fürchterlich darüber. Wie gerne hätte ich mit Thomas eine geistreiche Unterhaltung geführt um ihm zu zeigen, dass ich trotz meines jugendlichen Alters keine dumme, unwissende Pute war, doch ich kriegte die Zähne einfach nicht auseinander. Ärgerlich mit mir selbst und der ganzen Welt ging ich an diesem Abend zu Bett unwissend, welche große Überraschung der nächste Tag für mich offen halten sollte.
„Miss, es ist ein Packet für Sie gekommen“, teilte mir Sidonie aufgeregt mit, als ich nach der Schule das Haus durch die Küche betrat. Sie strahlte beinah vor Freude, während sie auf den in braunes Papier geschlagenen Gegenstand wies, der auf einem Tisch in der Ecke lag. „Ein junger Mann hat es heute früh vorbei gebracht. Ein gutaussehender Mann. Er hat gesagt ich soll es nur ihnen geben und niemand anderem.“ Sie zwinkerte mir kurz zu und wand sich dann wieder ihren Töpfen zu.
Langsam und voller Verwunderung trat ich an den kleinen Tisch und betrachtete das Geschenk. Keine Anschrift, kein Absender. Mit gerümpfter Nase zog ich an der dünnen Kordel und die Schleife öffnete sich. Dann hob ich den schweren Gegenstand auf, um das Papier zu entfernen und hielt schließlich eine Ausgabe von Homers Odyssee in der Hand. „Wow“, murmelte ich und meine Augen waren vor Erstaunen weit aufgerissen. Fast schon andächtig strich ich mit einer Hand über den ledernen Einband, der von seinem Alter und seiner Nutzung zeugte, dann schlug ich die erste Seite auf, wo in gut lesbarer Schrift ein paar Zeilen standen:
„Liebe Joanna. Wer die Ilias liest, der sollte sich die Odyssee nicht entgehen lassen. Meiner Meinung nach Homers bestes Werk und du wirst sicher Freude an der Romantik finden, wenn man bedenkt, was Odysseus alles auf sich nimmt um zurück nach Ithaka und natürlich zurück zu seiner Penelope zu gelangen. Ich glaube, ich wäre gewillt, ähnlich schlimme Strapazen auf mich zu nehmen, wenn ich wüsste, dass in der Heimat eine Dame auf mich wartet, die auf meine Rückkehr sehnt. Ergebenste Grüße, Thomas.“
Augenblicklich schoss mir sämtliches Blut in die Wangen, doch es war eher die romantische Geste dieses Geschenkes und der handgeschrieben Zeilen, die mich erfreute, als die Geschichte selbst. Leider bekam ich in den nächsten Tagen und Wochen keine Gelegenheit mich selbst bei Thomas zu bedanken, da dieser für die Armee unterwegs war. Und es sollten auch noch mehrere Wochen ins Land ziehen, bevor ich ihn überhaupt wiedersehen sollte.
Mitte April kam der Frühling über das Land und allerorts streckten die ersten Blumen ihre Köpfe aus der Erde. Ich liebte den Frühling über alle Maße und da man es in der Mittagssonne schon recht gut draußen aushalten konnte, ließ ich keine Gelegenheit ungenutzt, mich im Garten aufzuhalten. An diesem Nachmittag hatte ich es mir allerdings mit Mary im Garten ihrer Eltern auf einer Bank gemütlich gemacht. Ich hatte das Buch mitgenommen, das Thomas mir geschenkt hatte und in dem ich mit Freude las. Allerdings kam ich gar nicht erst zu lesen, da Mary, die sich zwar eigentlich mit ihrer Stickarbeit beschäftigen wollte, aber durchaus multitaskingfähig war, unablässig plauderte. Das Buch hatte ich neben mir auf die Bank gelegt und streckte mein Gesicht der Sonne entgegen, während ich mit einem Lächeln ihrem Tratsch lauschte.
„Oh und Georgia hat beschlossen ins Kloster zu gehen“, teilte sie mir völlig beiläufig mit, während sie einen neuen Faden erst zwischen ihren rosigen Lippen entlang zog und dann in das Nadelöhr schob.
„Sie hat was?“ Fassungslos starte ich meine Freundin an. Seit jenem schicksalhaften Abend, an dem meine Mutter offenbart hatte aus mir eine Novizin zu machen, bekam ich immer eine Gänsehaut, wenn ich an einem Kloster vorbei kam. Zum Glück gab es davon nicht all zu viele in Chicago. Ich mochte eine Eigenbrödlerin sein, die die Ruhe zu schätzen wusste, aber ein Leben hinter Klostermauern, das konnte und wollte ich mir gar nicht erst ausmalen. Und das jemand so ein Leben freiwillig wählen würde, dass war für mich das unvorstellbarste überhaupt.
„Naja.“ Mary zuckte mit den Schultern und stach die Nadel in den Stoff. „Sie will unbedingt Krankenschwester werden, aber ihre Mutter verbietet es. Also hat sie sich überlegt Nonne zu werden. Dann kann sie schließlich genauso gut als Krankenschwester tätig sein und ihre so gottesfürchtige Mutter kann ihr diesen Wunsch wohl kaum verweigern, wo diese doch noch öfter predigt als der Papst selbst.“ Sie kicherte und sah mich einen kurzen Augenblick verschwörerisch an. „Ihre Mutter kann nun also entscheiden Georgia Krankenschwester werden zu lassen und all die Pläne über den Haufen werfen, die sie für ihre Tochter gemacht hat oder sie ins Kloster gehen lassen, was ebenfalls mit sich brächte, dass Misses Aberdeen all ihre Pläne vergessen kann. So oder so kriegt Georgia ihren Willen und wenn du mich fragst find ich das gut. Sie will den Menschen helfen und wenn das ihr Wunsch ist, dann sollte man sie wirklich gewähren lassen.“
„Hmmm“, brummte ich nachdenklich vor mich hin und sann über Marys Worte nach. Natürlich hatte sie recht. Wenn es Georgias Wunsch war uneigennützig zu sein und anderen Menschen zu helfen, so war dies ein wirklich ehrbarer Wunsch. Und wenn sie bereit war, solch große Opfer dafür zu bringen, so war es nur umso ehrbarer. Ganz im Gegensatz zu meinen eigenen Wünschen. Eigentlich hatte ich momentan nur einen einzigen Wunsch und der war es Thomas endlich wieder zu sehen. Und wenn dies endlich geschah würde ich ihm nicht nur für das Buch danken, sondern auch endlich einmal die Zähne auseinander bekommen. Ich wollte ihn kennenlernen und ich wollte, dass er mich mochte. Ich war verliebt.
„Mary!“, rief eine Stimme aus dem Inneren des Hauses und meine Freundin verdrehte die Augen. „Das geht den ganzen Tag schon so. Seit unser Hausmädchen schwanger ist glaubt meine Mutter sie könne den Haushalt lieber alleine führen, anstatt eine Vertretung für Daphne einzustellen. Leider hat meine Mutter keine Ahnung davon, wie man einen Haushalt führt, wirft mir aber ständig vor ich wäre verwöhnt.“ Genervt ließ Mary ihren Stickrahmen auf die Bank fallen und rannte ins Haus. Leise lachend sah ich ihr einen Moment hinterher, dann griff ich nach dem Buch, um endlich weiter zu lesen.
„Wie ich sehe, hat meine kleine Aufmerksamkeit tatsächlich Anklang gefunden“, ließ mich eine mir bekannte Stimme hochfahren und als ich den Kopf zur Seite drehte stand Thomas vor mir. „Darf ich?“ Er deutete mit einer Hand auf den freien Platz auf der Bank und ich nickte ohne zu zögern. „Oh, du hast das Buch ja schon fast durch.“
„Naja, wenn mir ein Buch gefällt, dann kann ich mich nur schwerlich davon losreißen.“ Für Thomas machte ich natürlich eine Ausnahme und legte das Werk wieder zur Seite. „Vielleicht hat mein Cousin sogar recht und ich bin tatsächlich eine Leseratte und ein Mauerblümchen.“ Nachdenklich wiegte ich den Kopf hin und her. „Nichts desto trotz wollte ich dir für dieses wunderbare Geschenk danken.“ Stolz auf mich und meine Wortgewandtheit lächelte ich, obwohl es schon ein wenig komisch gewesen war ihn so vertraulich per Du anzusprechen. Aber er hatte damit angefangen.
„Ich glaube nicht, dass du das bist. Außerdem finde ich es sehr faszinierend. Man trifft nicht oft auf eine Frau, die ein solches Interesse an Büchern zeigt. Ich vermute sogar, dass Mary glaubt, Bücher dienen nur zu Schulung des aufrechten Ganges.“
Ich lachte auf und erlaubte es mir nun, ihm in die Augen zu sehen. Er erwiderte meinen Blick und ich bildete mir gar ein, dass er ein paar Zentimeter näher zu mir rutschte. „Dann liest du also auch gern?“
„Sehr gern sogar. Vielleicht ist das sogar einer der Gründe, warum ich nach England gegangen bin.“
„Das verstehe ich nicht.“ Irritiert schüttelte ich mit dem Kopf, da mir einfach nicht einleuchten wollte, was der Krieg mit seiner Leidenschaft für Bücher zu tun haben sollte.
„Naja.“ Thomas zuckte kurz mit den Schultern. „Im Krieg sitzt man hauptsächlich rum und wartet auf Befehle. Man kann nirgendwo hin und hat somit viel Zeit, die vertrieben werden will. Und ich vertreibe mir diese Zeit eben mit Büchern.“ Er drehte seinen Oberkörper ein wenig, um mich besser ansehen zu können, während er mir einen langen Vortrag über seine Lieblingswerke hielt und den Unterschied zwischen amerikanischer und europäischer Literatur. Ich wollte gerade Shakespeare verteidigen, dem Thomas nur mäßige Begeisterung entgegenbringen konnte, als er mir wie beiläufig eine Haarsträhne aus dem Gesicht hinter das Ohr strich und mich damit all meine Argumente vergessen machte. „Es war mir eine Freude mit dir zu plaudern, aber ich muss nun leider wieder los“, entschuldigte er sich und griff nach meiner Hand. Ohne jede Vorwarnung platzierte er einen zärtlichen Kuss auf meinem Handrücken, der mir den Atem raubte. „Ich hoffe wir sehen uns bald wieder.“
„Das hoffe ich auch“, erwiderte ich mit dünner Stimme und sah ihm hinterher, als er im Haus verschwand.
Von diesem Nachmittag an, trafen Thomas und ich uns regelmäßig, wann immer seine und auch meine freie Zeit es zuließ. Natürlich taten wir es heimlich und gerade das machte die Sache noch ein wenig reizvoller. Während unserer heimlichen Treffen führten wir hitzige Diskussionen über Literatur, er erzählte mir von seinem Leben als Soldat und ich ihm, warum ich nicht bei meinen Eltern lebte. Binnen kürzester Zeit waren wir einander so vertraut geworden, wie ich es mir in meinen Träumen immer vorgestellt hatte. Und da ich scheinbar nicht die einzige war, die sich Hals über Kopf verliebt hatte, kam es schon bald zum ersten Kuss. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als er plötzlich mein Gesicht in seinen Handflächen bettet, mich zu sich heran zog und seine Lippen ganz sanft auf die meinen legte. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl ich müsste sterben, aber es war ein honigsüßer Tod, den ich auf mich zu kommen sah. Und dann entpuppten sich die Schmetterlinge, die seit unserer ersten Begegnung in mir rumort hatten zu ihrer vollen Pracht und flatterten in meinem Bauch wild auf und ab. Ich war in diesem Moment so glücklich, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben gewesen war.
Ich glaube meine Tante hatte eine Vermutung, warum ich plötzlich so viel Zeit außer Haus verbrachte, doch sie sagte nichts, sondern gönnte mir mein Glück, dass den ganzen heißen Sommer über anhielt. Während dieser warmen Tage traf ich mich mit Thomas immer an einem kleinen Weiher in einem Waldstück, wo wir beisammen saßen, redeten und uns küssten. Die Zeit verging dabei allerdings immer viel zu schnell. Es war so ein Tag, an dem wir uns im Wald trafen, als Thomas mir mitteilte, dass er bald wieder für einige Wochen erst nach Cleveland und in naher Zukunft wohl wieder ganz nach England gehen müsse. Bei dieser Vorstellung zog sich mein Herz schmerzhaft zusammen. Es kostete mich meine ganze Selbstbeherrschung, damit ich nicht anfing loszuheulen und trotzdem konnte ich es nicht vermeiden, dass sich zwei Tränen unter meinen geschlossenen Lidern hervor stahlen und über meine Wangen liefen.
„Oh nein, Anni. Bitte weine nicht.“ Vorsichtig zog er mich näher zu sich und verwischte mit seinen Daumen meine Tränen. „Ich komme doch wieder.“
„Versprichst du es?“, schluchzte ich leise.
„Nichts in der Welt wird mich davon abhalten. Erinnerst du dich denn nicht mehr daran, was ich dir geschrieben hab? In das Buch?“
Ich zog unfein die Nase hoch und führte mir, die handgeschrieben Worte vor mein inneres Auge. Ich hatte die Zeilen so oft gelesen, dass ich sie auswendig kannte. Er hatte geschrieben, dass er jedes Wagnis auf sich nehmen würde, um nach Hause zurück zu kehren, wenn er wüsste, dass dort jemand auf ihn wartet. Wenn ICH dort auf ihn wartete. Ich lächelte schief und legte meine Hände auf die seinen die immer noch mein Gesicht umfasst hielten. „Du solltest lieber nicht so sein wie Odysseus“, beschied ich schließlich.
„Wieso nicht?“
„Weil er ein Sünder war. Er hat Ehebruch begangen, als er bei Kalypso gelebt hat. Er hat mehr als einmal gemordet, um sein Ziel zu erreichen und wurde dabei ein Stück weit auch von Habgier angetrieben“, faselte ich vor mich hin um mich von dem Schmerz abzulenken der in meinen Eingeweiden tobte. „Außerdem log er viel und gab sich als jemand aus, der er gar nicht war.“ Verwundert sah Thomas mich an und begann schließlich zu lachen.
Ich wusste, es würde mich in Stücke reißen, wenn ich dieses wundervolle Lachen so lange würde entbehren müssen, aber ich würde auf ihn warten, dessen war ich mir gewiss. Und so lange er noch bei mir war, wollte ich jede Minute auskosten, so gut es ging. Ich fasste in diesem Augenblick einen geradezu tollkühnen Entschluss. Mit meinen Händen umfasste ich sein Gesicht und drückte meine Lippen gierig auf seinen Mund, wobei ich ihn mit mir ins Gras drückte. Er erwiderte meinen Kuss mit Leidenschaft, bevor wir uns ebenfalls zu Sündern machten.
„Edward sagt Sie verbringen eure Zeit gerne mit Büchern, Joanna. Dürfte ich fragen, was Sie momentan lesen?“ Erwartungsvoll sah Thomas mich an und ich errötete.
„Die Ilias“, murmelte ich und errötete heftig. Schnell senkte ich meinen Blick wieder und schob mit meiner Gabel ein paar Bohnen von links nach rechts.
„Die Ilias.“ Anerkennung schwang in seiner Stimme. „Wahrlich keine leichte Lyrik.“
„Ja, unsere Joanna ist sehr belesen und sehr wissbegierig“, stimmte nun auch meine Tante mit ein und strich mir kurz über die Schulter. „Ich im Übrigen auch. Wie kommt es, dass du hier bist, Thomas? Wir haben dich ja wirklich lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Neigt sich der Krieg in Europa etwa dem Ende.“
„Ich fürchte, das Gegenteil ist der Fall, Ma‘am.“ Thomas seufzte. „Es sieht eher so aus, als könnten sich auch die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr lange aus diesem Krieg heraus halten. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Dieser Krieg wird in Europa bleiben und wird ohnehin hauptsächlich zur See ausgetragen. Ich bin hergekommen um neue Rekruten anzuwerben und kann gleichzeitig etwas Zeit mit meiner Familie verbringen.“
„Dann bleibst du also länger?“, hackte mein Onkel nach und Thomas nickte. Dann erzählte er vom Krieg und ich nutzte die Gelegenheit ihn anzusehen ohne unhöflich zu sein und tat so als würde ich zuhören, obwohl seine Worte fast ungehört an mir vorbei zogen. Edward hingegen lauschte seinen Erzählungen mit unverhohlenem Eifer. Auf unterschiedliche Art und Weise verehrten wir den jungen Mann wohl beide, nur das Edward keinen Hehl daraus machte.
Der Abend endete ohne, dass ich es geschafft hätte ein vernünftiges Wort herauszubringen und ich ärgerte mich fürchterlich darüber. Wie gerne hätte ich mit Thomas eine geistreiche Unterhaltung geführt um ihm zu zeigen, dass ich trotz meines jugendlichen Alters keine dumme, unwissende Pute war, doch ich kriegte die Zähne einfach nicht auseinander. Ärgerlich mit mir selbst und der ganzen Welt ging ich an diesem Abend zu Bett unwissend, welche große Überraschung der nächste Tag für mich offen halten sollte.
„Miss, es ist ein Packet für Sie gekommen“, teilte mir Sidonie aufgeregt mit, als ich nach der Schule das Haus durch die Küche betrat. Sie strahlte beinah vor Freude, während sie auf den in braunes Papier geschlagenen Gegenstand wies, der auf einem Tisch in der Ecke lag. „Ein junger Mann hat es heute früh vorbei gebracht. Ein gutaussehender Mann. Er hat gesagt ich soll es nur ihnen geben und niemand anderem.“ Sie zwinkerte mir kurz zu und wand sich dann wieder ihren Töpfen zu.
Langsam und voller Verwunderung trat ich an den kleinen Tisch und betrachtete das Geschenk. Keine Anschrift, kein Absender. Mit gerümpfter Nase zog ich an der dünnen Kordel und die Schleife öffnete sich. Dann hob ich den schweren Gegenstand auf, um das Papier zu entfernen und hielt schließlich eine Ausgabe von Homers Odyssee in der Hand. „Wow“, murmelte ich und meine Augen waren vor Erstaunen weit aufgerissen. Fast schon andächtig strich ich mit einer Hand über den ledernen Einband, der von seinem Alter und seiner Nutzung zeugte, dann schlug ich die erste Seite auf, wo in gut lesbarer Schrift ein paar Zeilen standen:
„Liebe Joanna. Wer die Ilias liest, der sollte sich die Odyssee nicht entgehen lassen. Meiner Meinung nach Homers bestes Werk und du wirst sicher Freude an der Romantik finden, wenn man bedenkt, was Odysseus alles auf sich nimmt um zurück nach Ithaka und natürlich zurück zu seiner Penelope zu gelangen. Ich glaube, ich wäre gewillt, ähnlich schlimme Strapazen auf mich zu nehmen, wenn ich wüsste, dass in der Heimat eine Dame auf mich wartet, die auf meine Rückkehr sehnt. Ergebenste Grüße, Thomas.“
Augenblicklich schoss mir sämtliches Blut in die Wangen, doch es war eher die romantische Geste dieses Geschenkes und der handgeschrieben Zeilen, die mich erfreute, als die Geschichte selbst. Leider bekam ich in den nächsten Tagen und Wochen keine Gelegenheit mich selbst bei Thomas zu bedanken, da dieser für die Armee unterwegs war. Und es sollten auch noch mehrere Wochen ins Land ziehen, bevor ich ihn überhaupt wiedersehen sollte.
Mitte April kam der Frühling über das Land und allerorts streckten die ersten Blumen ihre Köpfe aus der Erde. Ich liebte den Frühling über alle Maße und da man es in der Mittagssonne schon recht gut draußen aushalten konnte, ließ ich keine Gelegenheit ungenutzt, mich im Garten aufzuhalten. An diesem Nachmittag hatte ich es mir allerdings mit Mary im Garten ihrer Eltern auf einer Bank gemütlich gemacht. Ich hatte das Buch mitgenommen, das Thomas mir geschenkt hatte und in dem ich mit Freude las. Allerdings kam ich gar nicht erst zu lesen, da Mary, die sich zwar eigentlich mit ihrer Stickarbeit beschäftigen wollte, aber durchaus multitaskingfähig war, unablässig plauderte. Das Buch hatte ich neben mir auf die Bank gelegt und streckte mein Gesicht der Sonne entgegen, während ich mit einem Lächeln ihrem Tratsch lauschte.
„Oh und Georgia hat beschlossen ins Kloster zu gehen“, teilte sie mir völlig beiläufig mit, während sie einen neuen Faden erst zwischen ihren rosigen Lippen entlang zog und dann in das Nadelöhr schob.
„Sie hat was?“ Fassungslos starte ich meine Freundin an. Seit jenem schicksalhaften Abend, an dem meine Mutter offenbart hatte aus mir eine Novizin zu machen, bekam ich immer eine Gänsehaut, wenn ich an einem Kloster vorbei kam. Zum Glück gab es davon nicht all zu viele in Chicago. Ich mochte eine Eigenbrödlerin sein, die die Ruhe zu schätzen wusste, aber ein Leben hinter Klostermauern, das konnte und wollte ich mir gar nicht erst ausmalen. Und das jemand so ein Leben freiwillig wählen würde, dass war für mich das unvorstellbarste überhaupt.
„Naja.“ Mary zuckte mit den Schultern und stach die Nadel in den Stoff. „Sie will unbedingt Krankenschwester werden, aber ihre Mutter verbietet es. Also hat sie sich überlegt Nonne zu werden. Dann kann sie schließlich genauso gut als Krankenschwester tätig sein und ihre so gottesfürchtige Mutter kann ihr diesen Wunsch wohl kaum verweigern, wo diese doch noch öfter predigt als der Papst selbst.“ Sie kicherte und sah mich einen kurzen Augenblick verschwörerisch an. „Ihre Mutter kann nun also entscheiden Georgia Krankenschwester werden zu lassen und all die Pläne über den Haufen werfen, die sie für ihre Tochter gemacht hat oder sie ins Kloster gehen lassen, was ebenfalls mit sich brächte, dass Misses Aberdeen all ihre Pläne vergessen kann. So oder so kriegt Georgia ihren Willen und wenn du mich fragst find ich das gut. Sie will den Menschen helfen und wenn das ihr Wunsch ist, dann sollte man sie wirklich gewähren lassen.“
„Hmmm“, brummte ich nachdenklich vor mich hin und sann über Marys Worte nach. Natürlich hatte sie recht. Wenn es Georgias Wunsch war uneigennützig zu sein und anderen Menschen zu helfen, so war dies ein wirklich ehrbarer Wunsch. Und wenn sie bereit war, solch große Opfer dafür zu bringen, so war es nur umso ehrbarer. Ganz im Gegensatz zu meinen eigenen Wünschen. Eigentlich hatte ich momentan nur einen einzigen Wunsch und der war es Thomas endlich wieder zu sehen. Und wenn dies endlich geschah würde ich ihm nicht nur für das Buch danken, sondern auch endlich einmal die Zähne auseinander bekommen. Ich wollte ihn kennenlernen und ich wollte, dass er mich mochte. Ich war verliebt.
„Mary!“, rief eine Stimme aus dem Inneren des Hauses und meine Freundin verdrehte die Augen. „Das geht den ganzen Tag schon so. Seit unser Hausmädchen schwanger ist glaubt meine Mutter sie könne den Haushalt lieber alleine führen, anstatt eine Vertretung für Daphne einzustellen. Leider hat meine Mutter keine Ahnung davon, wie man einen Haushalt führt, wirft mir aber ständig vor ich wäre verwöhnt.“ Genervt ließ Mary ihren Stickrahmen auf die Bank fallen und rannte ins Haus. Leise lachend sah ich ihr einen Moment hinterher, dann griff ich nach dem Buch, um endlich weiter zu lesen.
„Wie ich sehe, hat meine kleine Aufmerksamkeit tatsächlich Anklang gefunden“, ließ mich eine mir bekannte Stimme hochfahren und als ich den Kopf zur Seite drehte stand Thomas vor mir. „Darf ich?“ Er deutete mit einer Hand auf den freien Platz auf der Bank und ich nickte ohne zu zögern. „Oh, du hast das Buch ja schon fast durch.“
„Naja, wenn mir ein Buch gefällt, dann kann ich mich nur schwerlich davon losreißen.“ Für Thomas machte ich natürlich eine Ausnahme und legte das Werk wieder zur Seite. „Vielleicht hat mein Cousin sogar recht und ich bin tatsächlich eine Leseratte und ein Mauerblümchen.“ Nachdenklich wiegte ich den Kopf hin und her. „Nichts desto trotz wollte ich dir für dieses wunderbare Geschenk danken.“ Stolz auf mich und meine Wortgewandtheit lächelte ich, obwohl es schon ein wenig komisch gewesen war ihn so vertraulich per Du anzusprechen. Aber er hatte damit angefangen.
„Ich glaube nicht, dass du das bist. Außerdem finde ich es sehr faszinierend. Man trifft nicht oft auf eine Frau, die ein solches Interesse an Büchern zeigt. Ich vermute sogar, dass Mary glaubt, Bücher dienen nur zu Schulung des aufrechten Ganges.“
Ich lachte auf und erlaubte es mir nun, ihm in die Augen zu sehen. Er erwiderte meinen Blick und ich bildete mir gar ein, dass er ein paar Zentimeter näher zu mir rutschte. „Dann liest du also auch gern?“
„Sehr gern sogar. Vielleicht ist das sogar einer der Gründe, warum ich nach England gegangen bin.“
„Das verstehe ich nicht.“ Irritiert schüttelte ich mit dem Kopf, da mir einfach nicht einleuchten wollte, was der Krieg mit seiner Leidenschaft für Bücher zu tun haben sollte.
„Naja.“ Thomas zuckte kurz mit den Schultern. „Im Krieg sitzt man hauptsächlich rum und wartet auf Befehle. Man kann nirgendwo hin und hat somit viel Zeit, die vertrieben werden will. Und ich vertreibe mir diese Zeit eben mit Büchern.“ Er drehte seinen Oberkörper ein wenig, um mich besser ansehen zu können, während er mir einen langen Vortrag über seine Lieblingswerke hielt und den Unterschied zwischen amerikanischer und europäischer Literatur. Ich wollte gerade Shakespeare verteidigen, dem Thomas nur mäßige Begeisterung entgegenbringen konnte, als er mir wie beiläufig eine Haarsträhne aus dem Gesicht hinter das Ohr strich und mich damit all meine Argumente vergessen machte. „Es war mir eine Freude mit dir zu plaudern, aber ich muss nun leider wieder los“, entschuldigte er sich und griff nach meiner Hand. Ohne jede Vorwarnung platzierte er einen zärtlichen Kuss auf meinem Handrücken, der mir den Atem raubte. „Ich hoffe wir sehen uns bald wieder.“
„Das hoffe ich auch“, erwiderte ich mit dünner Stimme und sah ihm hinterher, als er im Haus verschwand.
Von diesem Nachmittag an, trafen Thomas und ich uns regelmäßig, wann immer seine und auch meine freie Zeit es zuließ. Natürlich taten wir es heimlich und gerade das machte die Sache noch ein wenig reizvoller. Während unserer heimlichen Treffen führten wir hitzige Diskussionen über Literatur, er erzählte mir von seinem Leben als Soldat und ich ihm, warum ich nicht bei meinen Eltern lebte. Binnen kürzester Zeit waren wir einander so vertraut geworden, wie ich es mir in meinen Träumen immer vorgestellt hatte. Und da ich scheinbar nicht die einzige war, die sich Hals über Kopf verliebt hatte, kam es schon bald zum ersten Kuss. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als er plötzlich mein Gesicht in seinen Handflächen bettet, mich zu sich heran zog und seine Lippen ganz sanft auf die meinen legte. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl ich müsste sterben, aber es war ein honigsüßer Tod, den ich auf mich zu kommen sah. Und dann entpuppten sich die Schmetterlinge, die seit unserer ersten Begegnung in mir rumort hatten zu ihrer vollen Pracht und flatterten in meinem Bauch wild auf und ab. Ich war in diesem Moment so glücklich, wie ich es noch nie zuvor in meinem Leben gewesen war.
Ich glaube meine Tante hatte eine Vermutung, warum ich plötzlich so viel Zeit außer Haus verbrachte, doch sie sagte nichts, sondern gönnte mir mein Glück, dass den ganzen heißen Sommer über anhielt. Während dieser warmen Tage traf ich mich mit Thomas immer an einem kleinen Weiher in einem Waldstück, wo wir beisammen saßen, redeten und uns küssten. Die Zeit verging dabei allerdings immer viel zu schnell. Es war so ein Tag, an dem wir uns im Wald trafen, als Thomas mir mitteilte, dass er bald wieder für einige Wochen erst nach Cleveland und in naher Zukunft wohl wieder ganz nach England gehen müsse. Bei dieser Vorstellung zog sich mein Herz schmerzhaft zusammen. Es kostete mich meine ganze Selbstbeherrschung, damit ich nicht anfing loszuheulen und trotzdem konnte ich es nicht vermeiden, dass sich zwei Tränen unter meinen geschlossenen Lidern hervor stahlen und über meine Wangen liefen.
„Oh nein, Anni. Bitte weine nicht.“ Vorsichtig zog er mich näher zu sich und verwischte mit seinen Daumen meine Tränen. „Ich komme doch wieder.“
„Versprichst du es?“, schluchzte ich leise.
„Nichts in der Welt wird mich davon abhalten. Erinnerst du dich denn nicht mehr daran, was ich dir geschrieben hab? In das Buch?“
Ich zog unfein die Nase hoch und führte mir, die handgeschrieben Worte vor mein inneres Auge. Ich hatte die Zeilen so oft gelesen, dass ich sie auswendig kannte. Er hatte geschrieben, dass er jedes Wagnis auf sich nehmen würde, um nach Hause zurück zu kehren, wenn er wüsste, dass dort jemand auf ihn wartet. Wenn ICH dort auf ihn wartete. Ich lächelte schief und legte meine Hände auf die seinen die immer noch mein Gesicht umfasst hielten. „Du solltest lieber nicht so sein wie Odysseus“, beschied ich schließlich.
„Wieso nicht?“
„Weil er ein Sünder war. Er hat Ehebruch begangen, als er bei Kalypso gelebt hat. Er hat mehr als einmal gemordet, um sein Ziel zu erreichen und wurde dabei ein Stück weit auch von Habgier angetrieben“, faselte ich vor mich hin um mich von dem Schmerz abzulenken der in meinen Eingeweiden tobte. „Außerdem log er viel und gab sich als jemand aus, der er gar nicht war.“ Verwundert sah Thomas mich an und begann schließlich zu lachen.
Ich wusste, es würde mich in Stücke reißen, wenn ich dieses wundervolle Lachen so lange würde entbehren müssen, aber ich würde auf ihn warten, dessen war ich mir gewiss. Und so lange er noch bei mir war, wollte ich jede Minute auskosten, so gut es ging. Ich fasste in diesem Augenblick einen geradezu tollkühnen Entschluss. Mit meinen Händen umfasste ich sein Gesicht und drückte meine Lippen gierig auf seinen Mund, wobei ich ihn mit mir ins Gras drückte. Er erwiderte meinen Kuss mit Leidenschaft, bevor wir uns ebenfalls zu Sündern machten.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 4 Part 1
Rückblick
„Ich hab dir immer schon gesagt, dass du ihr zu viel durchgehen lässt. Jetzt siehst du, wo sowas hinführt“, hörte ich meinen Onkel brüllen und ich spielte mit dem Gedanken mir die Ohren zuzuhalten.
„Willst du jetzt etwa behaupten, dass es meine Schuld sei?“ Die Stimme meiner Tante war schrill.
„Nein. Natürlich ist es nicht deine Schuld. Es sind Giselles Gene die Schuld sind, aber du hättest sie besser im Zaum halten müssen.“
Wie in der Vergangenheit hatte ich mich auf die Treppe gehockt und lauschte der hitzigen Diskussion zwischen meinem Onkel und meiner Tante. Sie stritten sich, wie sie sich noch nie gestritten hatten. Wegen mir. Obwohl die Tür zum Arbeitszimmer dieses Mal ganz verschlossen war, konnte ich die Worte der Beiden so gut hören, als würden sie direkt neben mir stehen. Ohne Unterlass liefen mir die Tränen über die Wangen, von denen die rechte noch immer schmerzte wegen der schallenden Ohrfeige, die meine Tante mir verpasst hatte. Niemals hatte ich gedacht, dass sie eine solche Kraft hätte. Ich schniefte laut.
„Ich bitte dich. Das ist doch völlig Absurd. Anni ist nicht im Geringsten so wie ihre Mutter.“
„Ach nein? Und wie konnte das dann bitte passieren? Und wer ist überhaupt der Vater? Hat sie darüber bereits mal ein Wort verloren?“ Bei seinen Worten presste ich instinktiv eine Hand auf meinen noch flachen Bauch.
„Nein hat sie nicht, aber ich habe eine Vermutung.“
Hinter mir hörte ich eine Treppenstufe knarren. Ruckartig riss ich den Kopf nach oben und sah geradewegs in Edwards Augen, die mich völlig ausdruckslos anstarrten. „Ist…“ Er räusperte sich. „Ist Thomas der Vater?“, fragte er leise und ich nickte nur. Ich fühlte mich einfach zu kraftlos um noch irgendwas zu verheimlichen oder zu diskutieren. Ich war erschöpft.
Edward nickte kurz, als ich seinen Verdacht bestätigte und blickte mich immer noch an. Sein Gesicht wirkte auf mich wie eine Maske. Völlig emotionslos. Es war mir unmöglich zu sagen, ob er wütend auf mich war oder nur traurig. Seine Miene war einfach nur reglos. Für einen kurzen Moment wünschte ich mir, er würde mich anschreien und mir sagen, wie sehr ich ihn enttäuscht hätte. Alles wäre besser gewesen als dieses furchtbare Schweigen, das sich wie ein Messer in mein Herz bohrte.
„Weiß er es schon?“
Wahrheitsgemäß schüttelte ich den Kopf. Thomas war neun Wochen lang in Cleveland gewesen und wir hatten uns unzählige Briefe geschrieben, doch weder über meinen Verdacht noch über die letztendliche Tatsache hatte ich kein einziges Wort verloren. Thomas hatte Träume und große Pläne für sein Leben. Bald würde er wieder zurück nach England gehen und wenn der Krieg vorbei ist wollte er studieren und Lehrer werden. Ich fühlte mich nicht dazu im Stande ihm diese Träume zu zerstören. Das Beste wäre wohl, wenn er niemals von diesem Kind erfuhr.
„Wann kommt er zurück?“ Edward war die Treppe hinunter gegangen und stand nun vor mir. Und immer noch lag keinerlei Ausdruck in seinen Zügen.
„Heute.“ Meine Stimme war kratzig und heiser. Erst jetzt fiel mir auf, dass meine Kehle so trocken war, als hätte ich einen mehrtägigen Wüstenmarsch hinter mich gebracht. Und wäre das noch nicht schlimm genug, so schnürte mir die Verzweiflung gleichzeitig auch noch die Luft ab. Das Atmen fiel mir deutlich schwerer als sonst. „Wir wollten uns jetzt gleich treffen“, sagte ich mit einem Blick auf die große Standuhr im Flur. Armer Thomas. Er würde sicher sehr enttäuscht sein, wenn ich einfach nicht auftauchte. Aber was hatte ich schon für eine Wahl? Erstens hatte meine Tante mir deutlich klar gemacht, dass ich das Haus ohne ihre Erlaubnis nicht verlassen dürfte und zweitens würde es ihm leichter fallen mich zu vergessen, je eher ich einen Schlussstrich unter uns zog. Natürlich würde ich ihn sehr verletzen und wahrscheinlich würde er mich hassen, doch schon bald würde er wieder in England sein und wenn er zurück käme, wäre ich nicht mehr hier. Alleine bei dem Gedanken daran, ihn niemals wieder zu sehen verspürte ich den Wunsch zu sterben.
Ich schloss meine brennenden Augen nur für einen kurzen Moment und versuchte an etwas anderes zu denken. Als ich sie wieder öffnete sah ich, wie hinter Edward die Haustür ins Schloss fiel. Ich wollte rufen, aufstehen, ihm hinterher rennen, doch ich konnte nicht. Ich saß einfach da. Ein lebloser Körper, der all seine Kraft verloren hatte.
„Wenn du glaubst, dass ich das zulasse, dann hast du dich aber mächtig getäuscht, Edward!“, nahm ich nun wieder das Gespräch zwischen meinem Onkel und meiner Tante, die nun fast schon hysterisch klang wahr. „Es mag ja sein, dass sie einen Fehler gemacht hat. Einen riesigen Fehler sogar. Einen riesigen, dummen Fehler. Aber ich lasse nicht zu, dass sie dafür mit ihrem Leben bezahlt. Und sowas passiert dabei nämlich. Die Mädchen sterben.“
Ich brauchte nicht lange, um aus den Worten meiner Tante zu verstehen, was mein Onkel vorgeschlagen hatte. Er wollte, dass ich das Kind wegmachen ließ, damit niemals jemand von meiner Schande erfuhr. Aber das würde ich nicht zulassen und wenn ich dafür weglaufen müsste. Ich würde es irgendwie schaffen. Ohne die Hilfe von Thomas und zur Not auch ohne die Hilfe meiner Familie. Ich würde keinen Kurfuscher an mir rumschneiden und mein Kind töten lassen. Wenn das ihr Plan war, dann würden sie schon erst mich selbst töten müssen.
Ich lauschte wieder, doch das Gespräch im Arbeitszimmer war wie erstorben. Unheimliche Stille machte sich breit. Hart stieß ich die Luft aus meiner viel zu engen Lunge und legte meinen Kopf, der plötzlich furchtbar schwer schien gegen das hölzerne Treppengeländer. Ich schloss für einen weiteren Moment die Augen, bis ich ganz leise ein Geräusch vor der Haustür wahrnahm. Gedämpfte Stimmen, die sich offenbar ebenfalls stritten. Edwards und Thomas Stimmen. Ein winselnder Laut verließ meine Lippen, ohne das ich etwas dagegen hätte tun können. Ich mobilisierte meine letzten Kräfte und drückte mich von der Treppe hoch. Meine Beine schwankten, als ich versuchte zu gehen und ich war mir unsicher, ob sie mich tragen würden, doch ich schaffte es unbeschadet bis zur Tür. Meine Hände zitterten und kamen mir ungewohnt blass vor, als ich nach der Klinke griff, diese herunter drückte und dabei zusah, wie die Tür offen sprang. Und tatsächlich. Ich hatte mich nicht getäuscht. Vor mir standen Edward und Thomas.
Der Anblick Thomas ließ einen gewaltigen Schrecken durch meine Glieder fahren und das hatte gleich mehrere Gründe. Zum einen wollte ich nicht, dass er hier war. Ich wollte nicht, dass er irgendwas erfuhr und ich hatte keine Ahnung, was Edward ihm bereits erzählt hatte. Mein Cousin hatte in der Zwischenzeit allerdings die Maske der Unnahbarkeit abgelegt und schnaubte vor Wut, was wohl erklärte, warum Thomas´ Unterlippe aufgeplatzt war und ein dünner Blutfaden über sein Kinn lief.
„Oh Gott!“, entfuhr es mir erschreckt. „Was ist passiert?“ Ich wollte nach seinem Gesicht greifen und das Blut wegwischen, doch bevor ich ihn berühren konnte fasste er mich bei den Handgelenken und hielt mich davon ab. Wütend richtet ich meinen Blick auf Edward. „Warst du das?“, zischte ich ihn an, doch Edward blieb stumm. Ich befreite meine Handgelenke und ging auf meinen Cousin los. Mit den Fäusten trommelte ich auf seine Brust ein und schrie ihm dabei Worte entgegen, die ich ganz sicher nicht in Misses Campells Schule für junge Damen gelernt hatte.
„Hör auf damit, Anni!“ Thomas umfasste mich von hinten und zog mich von Edward weg, sodass meine wenig kraftvollen Schläge ins Leere gingen. „Hätte er Mary geschwängert, dann hätte ich ihm zur Begrüßung ebenfalls die Nase gebrochen. Im Übrigen wäre ich dir Dankbar gewesen, hätte ich diese … Neuigkeiten… von dir erfahren“, ließ er mich mit kühler Stimme wissen. Er wusste es also. Das unsichtbare Band um meine Kehle schnürte sich noch etwas enger zu und wieder begannen die Tränen wie Sturzbäche aus meinen Augen zu fließen. Ich wollte Thomas ansehen, doch hinter dem dichten Schleier konnte ich ihn kaum erkennen. Edward hatte mich verraten. Wie konnte er mir das nur antun?
Als ich aufgehört hatte mich zu wehren und Thomas sicher war, dass ich nicht wieder auf Edward losgehen würde ließ er mich los. Und noch bevor ich irgendwie reagieren konnte drehte er sich um und machte sich auf den Weg zum Arbeitszimmer meines Onkels. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich völlig perplex, dann rannte ich hinter ihm her. Kurz vor der Tür holte ich ihn ein und bekam ihn zu fassen. Die Tränen trübten immer noch meine Sicht, doch ich erkannte in Thomas Augen keine Wut auf mich, keine Enttäuschung oder Niedergeschlagenheit. Nur pure Entschlossenheit.
„Was hast du vor?“ Meine Stimme war so leise und krächzend, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob er mich überhaupt verstanden hatte.
„Na was wohl?“, herrschte er mich an und ich zuckte zusammen. „Ich gehe zu deinem Onkel und halte um deine Hand an. Er wird ja sagen müssen.“
„Dass…das musst du nicht tun.“ Ich bemühte mich redlich darum laut und deutlich zu sprechen, allerdings ohne jeden Erfolg.
„Du bist doch wirklich unglaublich, Anni.“ Ein kleines Lächeln huschte über sein schönes Gesicht. Behutsam griff er diesmal nach meinen Händen und zog mich zu sich heran um mich in die Arme zu schließen. Wie damals im Wald umfasste er mein Gesicht und wischte mit seinen Daumen meine Tränen hinfort, doch dieses Mal flossen Augenblicklich neue nach. „Ich hoffe, dass deine Meinung über mich nicht wirklich so schlecht ist, dass du es mir zutraust, dass du das alleine ausbaden musst. Wir waren beide dumm und unbedacht aber bisher habe ich noch immer zu allem gestanden was ich verbockt habe. Im Übrigen wollte ich dich ohnehin bitte meine Frau zu werden. Zwar dachte ich an eine Hochzeit erst nach meiner Rückkehr aus Europa, aber manchmal muss man seine Pläne eben ändern. Und jetzt sei kein Scharf. Ich liebe dich, Anni. Ich werde bestimmt nicht zusehen, wie Schimpf und Schande über dich herfallen wie die Geier.“ Zaghaft strichen seine weichen Lippen einen sanften Kuss auf meine feuchte Wange. Eine Unzahl von Gefühlen durchströmte meinen Körper und belebte meinen Geist wieder. Ich fühlte mich Geborgen in der Umarmung die Thomas mir schenkte und Erleichterung darüber, dass ich nicht alleine vor den Wölfen stand. Obwohl ich nicht gewollt hatte, dass Thomas seine Träume für eine Ehe und ein Kind mit mir aufgab, brauchte ich die Sicherheit die seine Nähe mir gab, um aufrecht stehen zu können. Egal was auch passieren würde, ich würde alles daran setzen, dass er trotzdem seine Pläne umsetzen könnte. Ich wollte kein Stein an seinem Bein sein, egal wie sehr mich liebte. Aber ich spürte auch Zorn. Zorn auf Edward, der mich so schändlich verraten hatten. Der ohne mein Wissen und ohne mein Einverständnis zu Thomas gegangen war und ihm alles erzählt hatte, obwohl ich das nicht gewollt hatte. Es war ein eigentümliches Gefühl. Ich hätte ihm ja vielmehr dankbar sein sollen, denn ohne ihn wäre Thomas nun nicht hier. Doch ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht dankbar sein. Er war ein Verräter.
„Ich hoffe du bist kein Schwätzer, der ihr irgendwelche Versprechungen macht und stehst zu deinem Wort.“ Entsetzt sah ich auf, als die Stimme meines Onkels die kurzzeitige Stille durchschnitt. Gemeinsam mit meiner Tante stand er nun im Flur und hatte wahrscheinlich jedes Wort von Thomas´ kleiner Ansprache mit angehört.
Thomas´ Augen verengten sich kurz, dann drehte er sich um. „Ich bin sicher kein Schwätzer, Mister Masen. Ich werde sie heiraten.“
„Gut gut.“ Mein Onkel nickte. „Wir sollten das Ganze in Ruhe besprechen.“ Er machte eine einladende Geste zum Arbeitszimmer dann sah er zu mir. „Und du solltest zu Bett gehen. Du siehst aus wie der Tod auf zwei Beinen.“
Verständnislos sah ich meinen Onkel an. Er hatte viel für mich getan, angefangen bei den 200 Dollar, die er meiner Mutter für mein Wohlergehen gezahlt hat. Er hatte mir ein Dach über dem Kopf gegeben, Essen, Kleidung und eine Familie, in der ich Liebe und Geborgenheit erfahren durfte. Aber wenn er glaubte, dass ich zu Bett ginge, während er mit Thomas über MEINE Zukunft diskutierte, dann hatte er sich aber gewaltig geirrt. „Ich werde sicher nicht schlafen gehen.“ Wütend stemmte ich die Hände in die Hüften und ich war froh, dass nicht nur mein Geist und mein Körper, sondern auch meine Stimme an Kraft gewonnen hatte. „Ihr redet über MICH! Also will ich auch dabei sein.“ Mein Onkel legte den Kopf schrägt, der eine leichte rötliche Färbung aufgrund meiner Ungehörigkeit angenommen hatte und musterte mich aus stechenden Augen. „Sag nichts. Ich weiß, dass ich ein furchtbares Kind bin. Mindestens genauso schlimm wie meine Mutter. Störrisch und ungehorsam und voller Schlechtigkeit. Aber wenn du mich jetzt nach oben schickst, dann werde ich mich deiner Anweisung widersetzen. Ich werde schnurstracks durch diese Tür gehen und mich im Michigansee ersäufen.“ Mit einem zitternden Finger deutete ich auf die Haustür, hielt dem Blick meines Onkels allerdings stand. Natürlich bluffte ich. In all meiner Verzweiflung war mir nicht einmal der Gedanke gekommen mir das Leben zu nehmen, doch es erschien mir als das Sinnvollste mit allen möglichen Mitteln zu kämpfen, um zu kriegen was ich wollte.
„Lass sie, Edward.“ Beschwichtigend legte meine Tante eine Hand auf den Arm ihres Gatten, um einem weiteren Streit vorzubeugen. Ich konnte förmlich sehen, wie die Gedanken hinter der Stirn meines Onkels rasten, doch schließlich gab er nach. Er winkte mich zu sich, drehte sich aber im selben Moment um und betrat als Erster sein Arbeitszimmer. Meine Tante und Thomas folgten ihm, genau wie ich. Als ich mich umdrehte, um die Tür zu schließen stand Edward immer noch im Flur. Sein Gesicht zeigte nun eine ganze Menge Regungen und Gefühle. Ich erkannte immer noch die Wut, aber ich sah auch Traurigkeit und vielleicht sogar Reue für sein Verhalten. Ich warf ihm einen hasserfüllten Blick zu und schloss die Tür.
„Ich hab dir immer schon gesagt, dass du ihr zu viel durchgehen lässt. Jetzt siehst du, wo sowas hinführt“, hörte ich meinen Onkel brüllen und ich spielte mit dem Gedanken mir die Ohren zuzuhalten.
„Willst du jetzt etwa behaupten, dass es meine Schuld sei?“ Die Stimme meiner Tante war schrill.
„Nein. Natürlich ist es nicht deine Schuld. Es sind Giselles Gene die Schuld sind, aber du hättest sie besser im Zaum halten müssen.“
Wie in der Vergangenheit hatte ich mich auf die Treppe gehockt und lauschte der hitzigen Diskussion zwischen meinem Onkel und meiner Tante. Sie stritten sich, wie sie sich noch nie gestritten hatten. Wegen mir. Obwohl die Tür zum Arbeitszimmer dieses Mal ganz verschlossen war, konnte ich die Worte der Beiden so gut hören, als würden sie direkt neben mir stehen. Ohne Unterlass liefen mir die Tränen über die Wangen, von denen die rechte noch immer schmerzte wegen der schallenden Ohrfeige, die meine Tante mir verpasst hatte. Niemals hatte ich gedacht, dass sie eine solche Kraft hätte. Ich schniefte laut.
„Ich bitte dich. Das ist doch völlig Absurd. Anni ist nicht im Geringsten so wie ihre Mutter.“
„Ach nein? Und wie konnte das dann bitte passieren? Und wer ist überhaupt der Vater? Hat sie darüber bereits mal ein Wort verloren?“ Bei seinen Worten presste ich instinktiv eine Hand auf meinen noch flachen Bauch.
„Nein hat sie nicht, aber ich habe eine Vermutung.“
Hinter mir hörte ich eine Treppenstufe knarren. Ruckartig riss ich den Kopf nach oben und sah geradewegs in Edwards Augen, die mich völlig ausdruckslos anstarrten. „Ist…“ Er räusperte sich. „Ist Thomas der Vater?“, fragte er leise und ich nickte nur. Ich fühlte mich einfach zu kraftlos um noch irgendwas zu verheimlichen oder zu diskutieren. Ich war erschöpft.
Edward nickte kurz, als ich seinen Verdacht bestätigte und blickte mich immer noch an. Sein Gesicht wirkte auf mich wie eine Maske. Völlig emotionslos. Es war mir unmöglich zu sagen, ob er wütend auf mich war oder nur traurig. Seine Miene war einfach nur reglos. Für einen kurzen Moment wünschte ich mir, er würde mich anschreien und mir sagen, wie sehr ich ihn enttäuscht hätte. Alles wäre besser gewesen als dieses furchtbare Schweigen, das sich wie ein Messer in mein Herz bohrte.
„Weiß er es schon?“
Wahrheitsgemäß schüttelte ich den Kopf. Thomas war neun Wochen lang in Cleveland gewesen und wir hatten uns unzählige Briefe geschrieben, doch weder über meinen Verdacht noch über die letztendliche Tatsache hatte ich kein einziges Wort verloren. Thomas hatte Träume und große Pläne für sein Leben. Bald würde er wieder zurück nach England gehen und wenn der Krieg vorbei ist wollte er studieren und Lehrer werden. Ich fühlte mich nicht dazu im Stande ihm diese Träume zu zerstören. Das Beste wäre wohl, wenn er niemals von diesem Kind erfuhr.
„Wann kommt er zurück?“ Edward war die Treppe hinunter gegangen und stand nun vor mir. Und immer noch lag keinerlei Ausdruck in seinen Zügen.
„Heute.“ Meine Stimme war kratzig und heiser. Erst jetzt fiel mir auf, dass meine Kehle so trocken war, als hätte ich einen mehrtägigen Wüstenmarsch hinter mich gebracht. Und wäre das noch nicht schlimm genug, so schnürte mir die Verzweiflung gleichzeitig auch noch die Luft ab. Das Atmen fiel mir deutlich schwerer als sonst. „Wir wollten uns jetzt gleich treffen“, sagte ich mit einem Blick auf die große Standuhr im Flur. Armer Thomas. Er würde sicher sehr enttäuscht sein, wenn ich einfach nicht auftauchte. Aber was hatte ich schon für eine Wahl? Erstens hatte meine Tante mir deutlich klar gemacht, dass ich das Haus ohne ihre Erlaubnis nicht verlassen dürfte und zweitens würde es ihm leichter fallen mich zu vergessen, je eher ich einen Schlussstrich unter uns zog. Natürlich würde ich ihn sehr verletzen und wahrscheinlich würde er mich hassen, doch schon bald würde er wieder in England sein und wenn er zurück käme, wäre ich nicht mehr hier. Alleine bei dem Gedanken daran, ihn niemals wieder zu sehen verspürte ich den Wunsch zu sterben.
Ich schloss meine brennenden Augen nur für einen kurzen Moment und versuchte an etwas anderes zu denken. Als ich sie wieder öffnete sah ich, wie hinter Edward die Haustür ins Schloss fiel. Ich wollte rufen, aufstehen, ihm hinterher rennen, doch ich konnte nicht. Ich saß einfach da. Ein lebloser Körper, der all seine Kraft verloren hatte.
„Wenn du glaubst, dass ich das zulasse, dann hast du dich aber mächtig getäuscht, Edward!“, nahm ich nun wieder das Gespräch zwischen meinem Onkel und meiner Tante, die nun fast schon hysterisch klang wahr. „Es mag ja sein, dass sie einen Fehler gemacht hat. Einen riesigen Fehler sogar. Einen riesigen, dummen Fehler. Aber ich lasse nicht zu, dass sie dafür mit ihrem Leben bezahlt. Und sowas passiert dabei nämlich. Die Mädchen sterben.“
Ich brauchte nicht lange, um aus den Worten meiner Tante zu verstehen, was mein Onkel vorgeschlagen hatte. Er wollte, dass ich das Kind wegmachen ließ, damit niemals jemand von meiner Schande erfuhr. Aber das würde ich nicht zulassen und wenn ich dafür weglaufen müsste. Ich würde es irgendwie schaffen. Ohne die Hilfe von Thomas und zur Not auch ohne die Hilfe meiner Familie. Ich würde keinen Kurfuscher an mir rumschneiden und mein Kind töten lassen. Wenn das ihr Plan war, dann würden sie schon erst mich selbst töten müssen.
Ich lauschte wieder, doch das Gespräch im Arbeitszimmer war wie erstorben. Unheimliche Stille machte sich breit. Hart stieß ich die Luft aus meiner viel zu engen Lunge und legte meinen Kopf, der plötzlich furchtbar schwer schien gegen das hölzerne Treppengeländer. Ich schloss für einen weiteren Moment die Augen, bis ich ganz leise ein Geräusch vor der Haustür wahrnahm. Gedämpfte Stimmen, die sich offenbar ebenfalls stritten. Edwards und Thomas Stimmen. Ein winselnder Laut verließ meine Lippen, ohne das ich etwas dagegen hätte tun können. Ich mobilisierte meine letzten Kräfte und drückte mich von der Treppe hoch. Meine Beine schwankten, als ich versuchte zu gehen und ich war mir unsicher, ob sie mich tragen würden, doch ich schaffte es unbeschadet bis zur Tür. Meine Hände zitterten und kamen mir ungewohnt blass vor, als ich nach der Klinke griff, diese herunter drückte und dabei zusah, wie die Tür offen sprang. Und tatsächlich. Ich hatte mich nicht getäuscht. Vor mir standen Edward und Thomas.
Der Anblick Thomas ließ einen gewaltigen Schrecken durch meine Glieder fahren und das hatte gleich mehrere Gründe. Zum einen wollte ich nicht, dass er hier war. Ich wollte nicht, dass er irgendwas erfuhr und ich hatte keine Ahnung, was Edward ihm bereits erzählt hatte. Mein Cousin hatte in der Zwischenzeit allerdings die Maske der Unnahbarkeit abgelegt und schnaubte vor Wut, was wohl erklärte, warum Thomas´ Unterlippe aufgeplatzt war und ein dünner Blutfaden über sein Kinn lief.
„Oh Gott!“, entfuhr es mir erschreckt. „Was ist passiert?“ Ich wollte nach seinem Gesicht greifen und das Blut wegwischen, doch bevor ich ihn berühren konnte fasste er mich bei den Handgelenken und hielt mich davon ab. Wütend richtet ich meinen Blick auf Edward. „Warst du das?“, zischte ich ihn an, doch Edward blieb stumm. Ich befreite meine Handgelenke und ging auf meinen Cousin los. Mit den Fäusten trommelte ich auf seine Brust ein und schrie ihm dabei Worte entgegen, die ich ganz sicher nicht in Misses Campells Schule für junge Damen gelernt hatte.
„Hör auf damit, Anni!“ Thomas umfasste mich von hinten und zog mich von Edward weg, sodass meine wenig kraftvollen Schläge ins Leere gingen. „Hätte er Mary geschwängert, dann hätte ich ihm zur Begrüßung ebenfalls die Nase gebrochen. Im Übrigen wäre ich dir Dankbar gewesen, hätte ich diese … Neuigkeiten… von dir erfahren“, ließ er mich mit kühler Stimme wissen. Er wusste es also. Das unsichtbare Band um meine Kehle schnürte sich noch etwas enger zu und wieder begannen die Tränen wie Sturzbäche aus meinen Augen zu fließen. Ich wollte Thomas ansehen, doch hinter dem dichten Schleier konnte ich ihn kaum erkennen. Edward hatte mich verraten. Wie konnte er mir das nur antun?
Als ich aufgehört hatte mich zu wehren und Thomas sicher war, dass ich nicht wieder auf Edward losgehen würde ließ er mich los. Und noch bevor ich irgendwie reagieren konnte drehte er sich um und machte sich auf den Weg zum Arbeitszimmer meines Onkels. Für den Bruchteil einer Sekunde war ich völlig perplex, dann rannte ich hinter ihm her. Kurz vor der Tür holte ich ihn ein und bekam ihn zu fassen. Die Tränen trübten immer noch meine Sicht, doch ich erkannte in Thomas Augen keine Wut auf mich, keine Enttäuschung oder Niedergeschlagenheit. Nur pure Entschlossenheit.
„Was hast du vor?“ Meine Stimme war so leise und krächzend, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob er mich überhaupt verstanden hatte.
„Na was wohl?“, herrschte er mich an und ich zuckte zusammen. „Ich gehe zu deinem Onkel und halte um deine Hand an. Er wird ja sagen müssen.“
„Dass…das musst du nicht tun.“ Ich bemühte mich redlich darum laut und deutlich zu sprechen, allerdings ohne jeden Erfolg.
„Du bist doch wirklich unglaublich, Anni.“ Ein kleines Lächeln huschte über sein schönes Gesicht. Behutsam griff er diesmal nach meinen Händen und zog mich zu sich heran um mich in die Arme zu schließen. Wie damals im Wald umfasste er mein Gesicht und wischte mit seinen Daumen meine Tränen hinfort, doch dieses Mal flossen Augenblicklich neue nach. „Ich hoffe, dass deine Meinung über mich nicht wirklich so schlecht ist, dass du es mir zutraust, dass du das alleine ausbaden musst. Wir waren beide dumm und unbedacht aber bisher habe ich noch immer zu allem gestanden was ich verbockt habe. Im Übrigen wollte ich dich ohnehin bitte meine Frau zu werden. Zwar dachte ich an eine Hochzeit erst nach meiner Rückkehr aus Europa, aber manchmal muss man seine Pläne eben ändern. Und jetzt sei kein Scharf. Ich liebe dich, Anni. Ich werde bestimmt nicht zusehen, wie Schimpf und Schande über dich herfallen wie die Geier.“ Zaghaft strichen seine weichen Lippen einen sanften Kuss auf meine feuchte Wange. Eine Unzahl von Gefühlen durchströmte meinen Körper und belebte meinen Geist wieder. Ich fühlte mich Geborgen in der Umarmung die Thomas mir schenkte und Erleichterung darüber, dass ich nicht alleine vor den Wölfen stand. Obwohl ich nicht gewollt hatte, dass Thomas seine Träume für eine Ehe und ein Kind mit mir aufgab, brauchte ich die Sicherheit die seine Nähe mir gab, um aufrecht stehen zu können. Egal was auch passieren würde, ich würde alles daran setzen, dass er trotzdem seine Pläne umsetzen könnte. Ich wollte kein Stein an seinem Bein sein, egal wie sehr mich liebte. Aber ich spürte auch Zorn. Zorn auf Edward, der mich so schändlich verraten hatten. Der ohne mein Wissen und ohne mein Einverständnis zu Thomas gegangen war und ihm alles erzählt hatte, obwohl ich das nicht gewollt hatte. Es war ein eigentümliches Gefühl. Ich hätte ihm ja vielmehr dankbar sein sollen, denn ohne ihn wäre Thomas nun nicht hier. Doch ich konnte nicht. Ich konnte einfach nicht dankbar sein. Er war ein Verräter.
„Ich hoffe du bist kein Schwätzer, der ihr irgendwelche Versprechungen macht und stehst zu deinem Wort.“ Entsetzt sah ich auf, als die Stimme meines Onkels die kurzzeitige Stille durchschnitt. Gemeinsam mit meiner Tante stand er nun im Flur und hatte wahrscheinlich jedes Wort von Thomas´ kleiner Ansprache mit angehört.
Thomas´ Augen verengten sich kurz, dann drehte er sich um. „Ich bin sicher kein Schwätzer, Mister Masen. Ich werde sie heiraten.“
„Gut gut.“ Mein Onkel nickte. „Wir sollten das Ganze in Ruhe besprechen.“ Er machte eine einladende Geste zum Arbeitszimmer dann sah er zu mir. „Und du solltest zu Bett gehen. Du siehst aus wie der Tod auf zwei Beinen.“
Verständnislos sah ich meinen Onkel an. Er hatte viel für mich getan, angefangen bei den 200 Dollar, die er meiner Mutter für mein Wohlergehen gezahlt hat. Er hatte mir ein Dach über dem Kopf gegeben, Essen, Kleidung und eine Familie, in der ich Liebe und Geborgenheit erfahren durfte. Aber wenn er glaubte, dass ich zu Bett ginge, während er mit Thomas über MEINE Zukunft diskutierte, dann hatte er sich aber gewaltig geirrt. „Ich werde sicher nicht schlafen gehen.“ Wütend stemmte ich die Hände in die Hüften und ich war froh, dass nicht nur mein Geist und mein Körper, sondern auch meine Stimme an Kraft gewonnen hatte. „Ihr redet über MICH! Also will ich auch dabei sein.“ Mein Onkel legte den Kopf schrägt, der eine leichte rötliche Färbung aufgrund meiner Ungehörigkeit angenommen hatte und musterte mich aus stechenden Augen. „Sag nichts. Ich weiß, dass ich ein furchtbares Kind bin. Mindestens genauso schlimm wie meine Mutter. Störrisch und ungehorsam und voller Schlechtigkeit. Aber wenn du mich jetzt nach oben schickst, dann werde ich mich deiner Anweisung widersetzen. Ich werde schnurstracks durch diese Tür gehen und mich im Michigansee ersäufen.“ Mit einem zitternden Finger deutete ich auf die Haustür, hielt dem Blick meines Onkels allerdings stand. Natürlich bluffte ich. In all meiner Verzweiflung war mir nicht einmal der Gedanke gekommen mir das Leben zu nehmen, doch es erschien mir als das Sinnvollste mit allen möglichen Mitteln zu kämpfen, um zu kriegen was ich wollte.
„Lass sie, Edward.“ Beschwichtigend legte meine Tante eine Hand auf den Arm ihres Gatten, um einem weiteren Streit vorzubeugen. Ich konnte förmlich sehen, wie die Gedanken hinter der Stirn meines Onkels rasten, doch schließlich gab er nach. Er winkte mich zu sich, drehte sich aber im selben Moment um und betrat als Erster sein Arbeitszimmer. Meine Tante und Thomas folgten ihm, genau wie ich. Als ich mich umdrehte, um die Tür zu schließen stand Edward immer noch im Flur. Sein Gesicht zeigte nun eine ganze Menge Regungen und Gefühle. Ich erkannte immer noch die Wut, aber ich sah auch Traurigkeit und vielleicht sogar Reue für sein Verhalten. Ich warf ihm einen hasserfüllten Blick zu und schloss die Tür.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 4 Part 2
Es wurde eine lange Nacht, in der viel diskutiert wurde. Da Thomas bereits 21 Jahre alt war, war er volljährig. Ich war es nicht. Mit unserer Heirat würde er also meine Vormundschaft übernehmen. Man beschloss allerdings, dass diese weiterhin meinem Onkel obläge, bis Thomas aus Europa zurückkehrte. Und das wir bis dahin bei meinem Onkel und meiner Tante leben würden, da ich ja schlecht ohne Geld alleine Leben könnte, wenn Thomas in ein paar Wochen das Land verließe. Ich war ein wenig erstaunt über die Professionalität, die mein Onkel plötzlich an den Tag legte. Als wäre sein Zorn im Nichts verschwunden erzählte er irgendwas von Verträgen die er aufsetzen würde und die Thomas unterzeichnen müsste. Er sagte sogar irgendwas über eine Mitgift, von der ich gar nicht gewusst hatte das es sie gab. Ich hörte ohnehin nur mit einem Ohr zu. Neben meiner Tante hatte ich auf dem Sofa Platz genommen und wir schwiegen, während sie die ganze Zeit meine Hand hielt. Irgendwann lehnte ich meinen Kopf an ihre Schulter. Ich war nicht länger dazu in der Lage meine Augen offen zu halten, die immer noch brannten, als hätte jemand Säure hinein gespritzt.
Als ich zwei Wochen später, in einem cremefarbenden und sehr schlichten Kleid den Mittelgang der Kirche zum Altar hinab schritt hatte das nicht im geringsten etwas mit der Traumhochzeit zu tun, die ich mir als kleines Mädchen immer vorgestellt hatte. Die Stimmung aller Anwesenden war kalt und distanziert und wenn ich die kleine Gästescharr auf den Bänken betrachtete hatte ich eher das Gefühl auf einer Beerdigung zu sein, als auf einer Hochzeit. Hinter vorgehaltenden Händen gaben Thomas Eltern mir die Schuld an dem was passiert war. Sie nannten mich ein liederliches Luder, das ihren Sohn verführt hatte. Im Gegenzug gab meine Familie Thomas die Schuld an meinem Zustand. Sie behaupteten, er hätte mein junges Alter und meine Naivität schamlos ausgenutzt, um seine Triebe an mir zu befriedigen. Doch für die Öffentlichkeit wahrten sie den schönen Schein. Die Einzige die wirklich ehrlich lächelte und das ganze überhaupt nicht schlimm fand war Mary. Was mir aber am meisten zu schaffen machte war, dass Edward gar nicht erst aufgetaucht war. Seit dem Abend an dem er mich verraten hatte, hatten wir nicht ein Wort miteinander gewechselt und Begegnungen vermieden. Doch jetzt wünschte ich ihn mir her. Um mir beizustehen, wie er es in der Vergangenheit immer getan hatte.
Vorsichtig pustete ich eine Haarsträhne aus meinem Gesicht, die sich aus der Hochsteckfrisur gelöst hatte. Einen Schleier trug ich nicht, denn das ziemte sich nicht für eine Frau, die bereits ein Kind trug. Wahrscheinlich konnte ich froh sein, dass ich überhaupt in einer Kirche heiraten durfte und die Zeremonie nicht auf einem Feld abgehalten wurde, wie es bei den Schwarzen der Fall war. Als ich vorne angekommen war legte ich meine kalte Hand in die von Thomas und war froh um den Halt, den wenigstens er mir gab. Ich zitterte am ganzen Körper wie Espenlaub, so kühl war die Atmosphäre. Die Predigt des Pfarrers kam mir unendlich lang vor, obwohl jedes seiner Worte ungehört an mir vorbei zog. Als die Zeit gekommen war sagte ich nach Thomas mein Gelübde auf, das ich im Vorfeld auswendig gelernt hatte und starrte unentwegt auf meine Hand, als Thomas mir den schmalen, silbernen Ring auf den weißen Finger schob. Dann war alles vorbei. Wir küssten uns kurz und formell. Niemand applaudierte oder jubelte, wie es bei anderen Trauungen der Fall war. Ich hackte mich bei Thomas unter und wir verließen gemeinsam die Kirche, gefolgt von der restlichen, schweigenden Festgemeinde, die lediglich aus dem engsten Familienkreis bestand.
Während des gesamten Festbanketts, das im Salon unseres Hauses abgehalten wurde, sprachen die Gäste nur das notwendigste miteinander. Und die meisten waren wohl froh, als die Regeln der Höflichkeit es ihnen endlich erlaubten zu gehen. Nur Mary war enttäuscht, dass die erste Hochzeit, an der sie wirklich teilnehmen durfte ein solches Trauerspiel stellte und Edward zeigte sich immer noch nicht. Ich wahrte Haltung, bis der letzte Gast gegangen war, dann sackte ich in mich zusammen. Trostlos ließ ich Kopf und Schultern hängen, während ein lauter Seufzer meine Lippen verließ.
„Erschöpft?“ Zärtlich rieb eine von Thomas Händen über meinen Rücken. Ich deutete ein Nicken an. Erschöpft war ich wirklich von diesem ganzen Schauspiel. So erschöpft, dass ich mich gar nicht so recht daran erfreuen konnte, dass der Mann, den ich so sehr liebte nun mein Ehemann war. „Wieso gehst du nicht schon nach oben? Ich hab noch kurz etwas mit deinem Onkel zu besprechen, dann komme ich nach.“ Wieder nickte ich und musste mich auf der Tischkante aufstützen, um auf die Beine zu kommen.
Schweigend verließ ich das große Esszimmer und ging zur Treppe. Meine Tante folgte mir. „Ich helfe dir“, sagte sie und lächelte mich zögerlich an. In meinem Zimmer half sie mir erst aus meinem Hochzeitskleid und schließlich in mein Nachthemd. Wortlos drückte sie mich auf einen Hocker und löste meine Frisur, um meine Haare zu kämen.
„Was besprechen die beiden denn?“, durchbrach ich schließlich die Stille, eigentlich nur um etwas Konversation zu betreiben. Doch die Reaktion meiner Tante, die plötzlich innehielt und schauderte, bevor sie die Bürste wieder ansetze machte mich misstrauisch. „Was?“, hackte ich deshalb nach.
„Naja, sie reden über Thomas´ Testament.“ Sie versuchte es beiläufig und unwichtig klingen zu lassen, doch es kam mir vor, als würde plötzlich ein Blitz in meinen Körper fahren. Ich war jetzt Misses Sommer und Thomas zog in den Krieg. Es war gut möglich, dass ich schon bald Thomas´ Witwe war. Ich bekam eine Gänsehaut und musste schluchzen.
„Ach Anni. Schatz.“ Seufzend legte meine Tante die Haarbürste zur Seite und zog mich zu sich hoch um mich in ihre Arme zu schließen. „Es wird schon alles gut werden. Du wirst sehen. Wir lieben dich und stehen zu dir, ganz gleich was passiert.“
Ganz gleich was passiert. Ihre Worte halten wieder und wieder durch meinen Kopf. Als Thomas endlich das Zimmer betrat lag ich bereits im Bett und war wieder einmal am weinen. Es grenzte schon fast an ein Wunder, dass ich überhaupt noch Tränen hatte. Wortlos legte er sich zu mir und strich mir tröstend über den Rücken, der unter meinen Tränen bebte. Ich weinte um all das was geschehen war. Weil ich es gewesen war, die sich dazu entschlossen hatte eine Sünderin zu sein und Thomas mit hinein gezogen hatte. Ich weinte, weil mein Entschluss unsere Familien entzweit und seine Pläne zunichte gemacht hatte. Ich weinte, um Edward und unseren Zwisten, der uns soweit voneinander entfernt hatte. Und irgendwann weinte ich nur noch aus Angst vor dem, was die Zukunft bringen würde.
„Alles wird gut“, flüsterte Thomas leise, als meine Tränen nach und nach versiegten und ich schmiegte mein Gesicht an seine Brust. Wenn ich in seinen Armen lag fühlte ich mich sicher. Nur dann konnte ich hoffe, das er Recht haben möge. Und ich ergab mich dem schönen Gefühl, dass seine Worte in mein Herz zauberten.
Alles wird wieder gut…
Als ich zwei Wochen später, in einem cremefarbenden und sehr schlichten Kleid den Mittelgang der Kirche zum Altar hinab schritt hatte das nicht im geringsten etwas mit der Traumhochzeit zu tun, die ich mir als kleines Mädchen immer vorgestellt hatte. Die Stimmung aller Anwesenden war kalt und distanziert und wenn ich die kleine Gästescharr auf den Bänken betrachtete hatte ich eher das Gefühl auf einer Beerdigung zu sein, als auf einer Hochzeit. Hinter vorgehaltenden Händen gaben Thomas Eltern mir die Schuld an dem was passiert war. Sie nannten mich ein liederliches Luder, das ihren Sohn verführt hatte. Im Gegenzug gab meine Familie Thomas die Schuld an meinem Zustand. Sie behaupteten, er hätte mein junges Alter und meine Naivität schamlos ausgenutzt, um seine Triebe an mir zu befriedigen. Doch für die Öffentlichkeit wahrten sie den schönen Schein. Die Einzige die wirklich ehrlich lächelte und das ganze überhaupt nicht schlimm fand war Mary. Was mir aber am meisten zu schaffen machte war, dass Edward gar nicht erst aufgetaucht war. Seit dem Abend an dem er mich verraten hatte, hatten wir nicht ein Wort miteinander gewechselt und Begegnungen vermieden. Doch jetzt wünschte ich ihn mir her. Um mir beizustehen, wie er es in der Vergangenheit immer getan hatte.
Vorsichtig pustete ich eine Haarsträhne aus meinem Gesicht, die sich aus der Hochsteckfrisur gelöst hatte. Einen Schleier trug ich nicht, denn das ziemte sich nicht für eine Frau, die bereits ein Kind trug. Wahrscheinlich konnte ich froh sein, dass ich überhaupt in einer Kirche heiraten durfte und die Zeremonie nicht auf einem Feld abgehalten wurde, wie es bei den Schwarzen der Fall war. Als ich vorne angekommen war legte ich meine kalte Hand in die von Thomas und war froh um den Halt, den wenigstens er mir gab. Ich zitterte am ganzen Körper wie Espenlaub, so kühl war die Atmosphäre. Die Predigt des Pfarrers kam mir unendlich lang vor, obwohl jedes seiner Worte ungehört an mir vorbei zog. Als die Zeit gekommen war sagte ich nach Thomas mein Gelübde auf, das ich im Vorfeld auswendig gelernt hatte und starrte unentwegt auf meine Hand, als Thomas mir den schmalen, silbernen Ring auf den weißen Finger schob. Dann war alles vorbei. Wir küssten uns kurz und formell. Niemand applaudierte oder jubelte, wie es bei anderen Trauungen der Fall war. Ich hackte mich bei Thomas unter und wir verließen gemeinsam die Kirche, gefolgt von der restlichen, schweigenden Festgemeinde, die lediglich aus dem engsten Familienkreis bestand.
Während des gesamten Festbanketts, das im Salon unseres Hauses abgehalten wurde, sprachen die Gäste nur das notwendigste miteinander. Und die meisten waren wohl froh, als die Regeln der Höflichkeit es ihnen endlich erlaubten zu gehen. Nur Mary war enttäuscht, dass die erste Hochzeit, an der sie wirklich teilnehmen durfte ein solches Trauerspiel stellte und Edward zeigte sich immer noch nicht. Ich wahrte Haltung, bis der letzte Gast gegangen war, dann sackte ich in mich zusammen. Trostlos ließ ich Kopf und Schultern hängen, während ein lauter Seufzer meine Lippen verließ.
„Erschöpft?“ Zärtlich rieb eine von Thomas Händen über meinen Rücken. Ich deutete ein Nicken an. Erschöpft war ich wirklich von diesem ganzen Schauspiel. So erschöpft, dass ich mich gar nicht so recht daran erfreuen konnte, dass der Mann, den ich so sehr liebte nun mein Ehemann war. „Wieso gehst du nicht schon nach oben? Ich hab noch kurz etwas mit deinem Onkel zu besprechen, dann komme ich nach.“ Wieder nickte ich und musste mich auf der Tischkante aufstützen, um auf die Beine zu kommen.
Schweigend verließ ich das große Esszimmer und ging zur Treppe. Meine Tante folgte mir. „Ich helfe dir“, sagte sie und lächelte mich zögerlich an. In meinem Zimmer half sie mir erst aus meinem Hochzeitskleid und schließlich in mein Nachthemd. Wortlos drückte sie mich auf einen Hocker und löste meine Frisur, um meine Haare zu kämen.
„Was besprechen die beiden denn?“, durchbrach ich schließlich die Stille, eigentlich nur um etwas Konversation zu betreiben. Doch die Reaktion meiner Tante, die plötzlich innehielt und schauderte, bevor sie die Bürste wieder ansetze machte mich misstrauisch. „Was?“, hackte ich deshalb nach.
„Naja, sie reden über Thomas´ Testament.“ Sie versuchte es beiläufig und unwichtig klingen zu lassen, doch es kam mir vor, als würde plötzlich ein Blitz in meinen Körper fahren. Ich war jetzt Misses Sommer und Thomas zog in den Krieg. Es war gut möglich, dass ich schon bald Thomas´ Witwe war. Ich bekam eine Gänsehaut und musste schluchzen.
„Ach Anni. Schatz.“ Seufzend legte meine Tante die Haarbürste zur Seite und zog mich zu sich hoch um mich in ihre Arme zu schließen. „Es wird schon alles gut werden. Du wirst sehen. Wir lieben dich und stehen zu dir, ganz gleich was passiert.“
Ganz gleich was passiert. Ihre Worte halten wieder und wieder durch meinen Kopf. Als Thomas endlich das Zimmer betrat lag ich bereits im Bett und war wieder einmal am weinen. Es grenzte schon fast an ein Wunder, dass ich überhaupt noch Tränen hatte. Wortlos legte er sich zu mir und strich mir tröstend über den Rücken, der unter meinen Tränen bebte. Ich weinte um all das was geschehen war. Weil ich es gewesen war, die sich dazu entschlossen hatte eine Sünderin zu sein und Thomas mit hinein gezogen hatte. Ich weinte, weil mein Entschluss unsere Familien entzweit und seine Pläne zunichte gemacht hatte. Ich weinte, um Edward und unseren Zwisten, der uns soweit voneinander entfernt hatte. Und irgendwann weinte ich nur noch aus Angst vor dem, was die Zukunft bringen würde.
„Alles wird gut“, flüsterte Thomas leise, als meine Tränen nach und nach versiegten und ich schmiegte mein Gesicht an seine Brust. Wenn ich in seinen Armen lag fühlte ich mich sicher. Nur dann konnte ich hoffe, das er Recht haben möge. Und ich ergab mich dem schönen Gefühl, dass seine Worte in mein Herz zauberten.
Alles wird wieder gut…
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 5 Part 1
*Rückblick*
Ich befand mich an Board eines kleinen Schiffes und blickte auf das weite Meer. Vor mir lag nichts als der weite Horizont, hinter dem die Sonne allmählich verschwand. Der Wind spielte in meinen schwarzen Haaren und immer wieder wurden mir Strähnen ins Gesicht geblasen. Mit beiden Händen hielt ich mich an der Reling fest und beugte mich dann vorsichtig nach vorne. Trotz des Windes lag das Wasser ganz still vor mir. Es hatte allerdings eine unnatürlich rote Färbung. Wahrscheinlich handelte es sich hierbei um eine Spiegelung des Sonnenunterganges. Ich erwartete, mein eigenes Spiegelbild auf der glatten Oberfläche sehe zu können, doch ich irrte mich. Statt in mein eigenes Konterfei, sah ich geradewegs in Thomas´ schönes Gesicht, das von dem roten Wasser umspült wurde wie von Blut.
Von Schrecken erfüllt und mit rasendem Herzen fuhr ich hoch. Ich musste gegen die grellen Sonnenstrahlen anblinzeln, die durch die Fenster in mein Schlafzimmerströmten. „Nur ein Traum“, murmelte ich leise, um mich selbst zu beruhigen und sah mich um. Die rechte Seite meines Bettes war bereits leer. Der Tag, den ich so sehr gefürchtet hatte war gekommen.
„Mach dir nicht so viele Sorgen. Davon bekommt man nur Falten“, neckte mich Thomas und strich mir gleichzeitig eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Das ist ein Seekrieg, Liebes und ich bin nicht bei der Marine. Die paar Bodengefechte die wir austragen, kann man besten Falls Scharmützel nennen. Ich werde viel lesen und wenn ich wieder zurück bin diskutieren wir die gesamte englische Literatur, bis du umfällst und dir wünscht, ich wäre doch gefallen.“
Er lächelte, doch ich konnte so gar nichts Humorvolles in seinen Worten entdecken. Trotzdem versuchte ich nicht verkniffener als notwendig aus der Wäsche zu gucken. Er war es immerhin, der in den Krieg zog, während ich mich in die Sicherheit eines Heimes zurück ziehen konnte. Es war meine Pflicht, ihm den Abschied nicht schwerer als zwingend notwendig zu machen. Eine der gewaltigen Lokomotiven, von denen ein gutes dutzend im Bahnhof von Chicago standen stieß einen lauten Pfiff aus und ich erschreckte mich so heftig, das ich fast über Thomas Tasche gefallen wäre, die zwischen uns auf dem Boden stand. Der ganze Bahnsteig war gesäumt von Soldaten, die Abschied von ihren Familien, Frauen und Freunden nahmen, genau wie Thomas und ich. „Ich werde dich unendlich vermissen“, brachte ich erstickt hervor und ließ mich in seine Arme fallen.
„Ich dich auch.“ Ich konnte Thomas´ warmen Atem an meinem Haar spüren, als er seine Arme um mich schloss und mich so fest hielt, als würde er mich nie wieder los lassen wollen. Und ich tat es ihm gleich und versuchte ihn mit aller Kraft festzuhalten, damit er bei mir blieb, obwohl ich wusste, dass es zwecklos war. „Ich komme wieder“, flüsterte er mir zärtlich zu und löste meine Arme, die seine Taille wie in einem Schraubstock gefangen hielten.
„Versprich mir, dass du wieder kommst, bevor unser Sohn erwachsen ist“, erinnerte ich ihn an Odysseus und sein Versprechen, während ich mit dem Handrücken meine Tränen trocknete.
„Ich verspreche dir, dass ich wieder hier sein werde, um jedem Jüngling die Hammelbeine lang zu ziehen, der unserer Tochter schöne Augen macht.“ Wir lachten beide auf, doch die Stimmung trübte sich augenblicklich wieder, als ich sah, wie die ersten Soldaten bereits in den Zug gestiegen waren und auch mein Abschied von Thomas sich nicht länger würde hinauszögern lassen.
Gierig verschränkte ich ein letztes Mal meine Hände in seinem Nacken und presste mich an ihn. Wir tauschten einen Kuss voller Liebe und Leidenschaft, voller Sehnsucht und Hoffnung aber auch voller Angst und Wut. Ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde, ihn jemals wieder loszulassen, doch irgendwie gelang es mir schließlich doch, mich zu überwinden. Ich trat einen Schritt zurück und sah ihn ein letztes Mal ganz genau an. Von oben bis unten versuchte ich mir alles von ihm einzuprägen. Seine Gestallt, seine Züge, seine Bewegungen, sein Lächeln… Tief atmete ich durch und wies zur Tür der wartenden Bahn. „Pass gut auf dich auf.“
„Und du gut auf euch.“ Seine Hand liebkoste kurz meine Wange und strich dann über meinen Bauch. Auch ihn kostete es sichtlich Überwindung, sich nach seiner Tasche zu bücken und diese aufzuheben, doch schließlich tat er es. Ich konnte das feuchte Glitzern in seinen Augen sehen, als er auf die erste Stufe trat, seinen Blick aber nicht von mir abwand. Dann verschwand er für einen kurzen Augenblick im Inneren des Wagons, nur um wenige Sekunden später an dem großen Fenster neben mir, wieder aufzutauchen. Mit etwas Kraft legte er den Riegel um und drückte das Fenster runter. Nun befand sich keiner der Soldaten mehr am Bahnsteig und die Türen des Zugs schlossen sich. „Ich liebe dich!“ Mit einem Grollen setzten sich die Räder in Bewegung und wieder ertönte ein Mark und Bein erschütternder Pfiff.
Ich versuchte ihn anzulächeln, denn ich wollte nicht, dass er mich in Tränen aufgelöst in Erinnerung behielt. „Ich liebe dich auch!“ Ich musste schreien, um den Lärm der Eisenbahn zu übertönen, die nun losrollte. Genau wie jede Menge anderer Frauen stand ich einfach nur da und winkte, bis der Zug in der Ferne verschwunden war und es Zeit wurde nach Hause zu gehen.
Ohne große Eile betrat ich die Wartehalle des Bahnhofs, um zurück auf die Straße zu gelangen, doch etwas schob sich in mein Blickfeld, das meinen Gang noch weiter verlangsamte, bis ich schließlich stehen blieb. Auf einer der massiven Holzbänke saß Edward. Die ganzen letzten Tage hatte ich kaum mehr als seinen Schatten von ihm zu Gesicht bekommen und jetzt saß er einfach so da? Mit vor der Brust verschränkten Armen und verkniffenem Gesicht sah er mich an, bevor er aufstand und ein paar Schritte auf mich zu machte.
Ich spürte ein leichtes Kribbeln in meinen Fingerspitzen, als er näher kam und musste mich zusammenreißen, um nicht die Hand gegen ihn zu erheben, so groß war mein Zorn auf ihn. „Was willst du hier?“, fuhr ich ihn stattdessen bitter an. Er war es gewesen, der Thomas alles erzählt und mich somit hintergangen hatte. Und er war es auch gewesen, der sich dann der Verantwortung entzogen hatte und es noch nicht einmal für nötig gehalten hatte, auf meiner Hochzeit zu erscheinen. All das, würde ich ihm nicht so einfach verzeihen können, so sehr sich mein Herz auch nach einer schützenden Umarmung von ihm sehnte.
„Du bist also immer noch wütend auf mich?“ Seine Stimme war leise, aber fest, als hätte er mit nichts anderem gerechnet.
„Ich finde, ich habe gute Gründe“, entgegnete ich kühl und kreuzte ebenfalls meine Arme.
„Anni ich…“ Er machte einen weiteren Schritt nach vorn, in der Absicht mich zu berühren. Ob meines bösen Blickes überlegte er es sich dann allerdings doch anders und ließ die Arme hängen. „Du musst doch zugeben, dass es besser ist für dich und das Kind, wenn du und Thomas verheiratet seid. Außerdem hatte er ein Recht darauf es zu erfahren. Du liebst ihn und er liebt dich, was zur Hölle ist dein Problem?“
„Was mein Problem ist?“ Meine Hände ballten sich zu so festen Fäusten, dass meine Unterarme zu zittern begannen. „Mein Problem ist, dass mich scheinbar jeder für zu blöd hält, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du schon hinter meinem Rücken für mich entscheidest, dann erweis mir wenigstens so viel Respekt und steh dazu und verkriech dich nicht feige, wenn dein Verhalten Konsequenzen zieht. Oder konntest du etwa den unglücklichen Blick deiner Cousine nicht ertragen, als sie zum Altar schritt?“ Meine Stimme war pures Gift und Edward zuckte merklich zusammen. Natürlich hatte Edward recht und die Hochzeit war das Beste für mich und das Kind gewesen. Was allerdings das Beste für Thomas gewesen wäre, das stand auf einem ganz anderen Blatt und würde mich ein Leben lang quälen. Und nichts desto trotz hätte Edward da sein müssen, um mir Kraft zu geben. Das wäre er mir schuldig gewesen.
„Ich hatte wirklich nur gute Absichten, Anni. Das musst du mir glauben.“ Flehend sah Edward mich an und für einen Moment war ich versucht ihm zu verzeihen, doch dieser Moment wehrte nur kurz. Nicht ein Wort der Entschuldigung war über seine Lippen gekommen, nicht eine Bitte des Verzeihens. Mein Mann war so eben in den Krieg gezogen und vielleicht war ich bald schon eine Witwe. Eine Ungewissheit, die sich wie ein Messer in mein Herz und meine Seele bohrte.
„Der Weg zu Hölle ist mit guten Absichten gepflastert, Edward.“ Noch während ich die Worte aussprach, taten sie mir auch schon leid, doch sie linderten nicht meine Wut. Ich drehte mich auf dem Absatz um und lief fast zu den großen Flügeltüren ins Freie, ohne mich auch noch einmal umzusehen.
Von Schrecken erfüllt und mit rasendem Herzen fuhr ich hoch. Ich musste gegen die grellen Sonnenstrahlen anblinzeln, die durch die Fenster in mein Schlafzimmerströmten. „Nur ein Traum“, murmelte ich leise, um mich selbst zu beruhigen und sah mich um. Die rechte Seite meines Bettes war bereits leer. Der Tag, den ich so sehr gefürchtet hatte war gekommen.
„Mach dir nicht so viele Sorgen. Davon bekommt man nur Falten“, neckte mich Thomas und strich mir gleichzeitig eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Das ist ein Seekrieg, Liebes und ich bin nicht bei der Marine. Die paar Bodengefechte die wir austragen, kann man besten Falls Scharmützel nennen. Ich werde viel lesen und wenn ich wieder zurück bin diskutieren wir die gesamte englische Literatur, bis du umfällst und dir wünscht, ich wäre doch gefallen.“
Er lächelte, doch ich konnte so gar nichts Humorvolles in seinen Worten entdecken. Trotzdem versuchte ich nicht verkniffener als notwendig aus der Wäsche zu gucken. Er war es immerhin, der in den Krieg zog, während ich mich in die Sicherheit eines Heimes zurück ziehen konnte. Es war meine Pflicht, ihm den Abschied nicht schwerer als zwingend notwendig zu machen. Eine der gewaltigen Lokomotiven, von denen ein gutes dutzend im Bahnhof von Chicago standen stieß einen lauten Pfiff aus und ich erschreckte mich so heftig, das ich fast über Thomas Tasche gefallen wäre, die zwischen uns auf dem Boden stand. Der ganze Bahnsteig war gesäumt von Soldaten, die Abschied von ihren Familien, Frauen und Freunden nahmen, genau wie Thomas und ich. „Ich werde dich unendlich vermissen“, brachte ich erstickt hervor und ließ mich in seine Arme fallen.
„Ich dich auch.“ Ich konnte Thomas´ warmen Atem an meinem Haar spüren, als er seine Arme um mich schloss und mich so fest hielt, als würde er mich nie wieder los lassen wollen. Und ich tat es ihm gleich und versuchte ihn mit aller Kraft festzuhalten, damit er bei mir blieb, obwohl ich wusste, dass es zwecklos war. „Ich komme wieder“, flüsterte er mir zärtlich zu und löste meine Arme, die seine Taille wie in einem Schraubstock gefangen hielten.
„Versprich mir, dass du wieder kommst, bevor unser Sohn erwachsen ist“, erinnerte ich ihn an Odysseus und sein Versprechen, während ich mit dem Handrücken meine Tränen trocknete.
„Ich verspreche dir, dass ich wieder hier sein werde, um jedem Jüngling die Hammelbeine lang zu ziehen, der unserer Tochter schöne Augen macht.“ Wir lachten beide auf, doch die Stimmung trübte sich augenblicklich wieder, als ich sah, wie die ersten Soldaten bereits in den Zug gestiegen waren und auch mein Abschied von Thomas sich nicht länger würde hinauszögern lassen.
Gierig verschränkte ich ein letztes Mal meine Hände in seinem Nacken und presste mich an ihn. Wir tauschten einen Kuss voller Liebe und Leidenschaft, voller Sehnsucht und Hoffnung aber auch voller Angst und Wut. Ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde, ihn jemals wieder loszulassen, doch irgendwie gelang es mir schließlich doch, mich zu überwinden. Ich trat einen Schritt zurück und sah ihn ein letztes Mal ganz genau an. Von oben bis unten versuchte ich mir alles von ihm einzuprägen. Seine Gestallt, seine Züge, seine Bewegungen, sein Lächeln… Tief atmete ich durch und wies zur Tür der wartenden Bahn. „Pass gut auf dich auf.“
„Und du gut auf euch.“ Seine Hand liebkoste kurz meine Wange und strich dann über meinen Bauch. Auch ihn kostete es sichtlich Überwindung, sich nach seiner Tasche zu bücken und diese aufzuheben, doch schließlich tat er es. Ich konnte das feuchte Glitzern in seinen Augen sehen, als er auf die erste Stufe trat, seinen Blick aber nicht von mir abwand. Dann verschwand er für einen kurzen Augenblick im Inneren des Wagons, nur um wenige Sekunden später an dem großen Fenster neben mir, wieder aufzutauchen. Mit etwas Kraft legte er den Riegel um und drückte das Fenster runter. Nun befand sich keiner der Soldaten mehr am Bahnsteig und die Türen des Zugs schlossen sich. „Ich liebe dich!“ Mit einem Grollen setzten sich die Räder in Bewegung und wieder ertönte ein Mark und Bein erschütternder Pfiff.
Ich versuchte ihn anzulächeln, denn ich wollte nicht, dass er mich in Tränen aufgelöst in Erinnerung behielt. „Ich liebe dich auch!“ Ich musste schreien, um den Lärm der Eisenbahn zu übertönen, die nun losrollte. Genau wie jede Menge anderer Frauen stand ich einfach nur da und winkte, bis der Zug in der Ferne verschwunden war und es Zeit wurde nach Hause zu gehen.
Ohne große Eile betrat ich die Wartehalle des Bahnhofs, um zurück auf die Straße zu gelangen, doch etwas schob sich in mein Blickfeld, das meinen Gang noch weiter verlangsamte, bis ich schließlich stehen blieb. Auf einer der massiven Holzbänke saß Edward. Die ganzen letzten Tage hatte ich kaum mehr als seinen Schatten von ihm zu Gesicht bekommen und jetzt saß er einfach so da? Mit vor der Brust verschränkten Armen und verkniffenem Gesicht sah er mich an, bevor er aufstand und ein paar Schritte auf mich zu machte.
Ich spürte ein leichtes Kribbeln in meinen Fingerspitzen, als er näher kam und musste mich zusammenreißen, um nicht die Hand gegen ihn zu erheben, so groß war mein Zorn auf ihn. „Was willst du hier?“, fuhr ich ihn stattdessen bitter an. Er war es gewesen, der Thomas alles erzählt und mich somit hintergangen hatte. Und er war es auch gewesen, der sich dann der Verantwortung entzogen hatte und es noch nicht einmal für nötig gehalten hatte, auf meiner Hochzeit zu erscheinen. All das, würde ich ihm nicht so einfach verzeihen können, so sehr sich mein Herz auch nach einer schützenden Umarmung von ihm sehnte.
„Du bist also immer noch wütend auf mich?“ Seine Stimme war leise, aber fest, als hätte er mit nichts anderem gerechnet.
„Ich finde, ich habe gute Gründe“, entgegnete ich kühl und kreuzte ebenfalls meine Arme.
„Anni ich…“ Er machte einen weiteren Schritt nach vorn, in der Absicht mich zu berühren. Ob meines bösen Blickes überlegte er es sich dann allerdings doch anders und ließ die Arme hängen. „Du musst doch zugeben, dass es besser ist für dich und das Kind, wenn du und Thomas verheiratet seid. Außerdem hatte er ein Recht darauf es zu erfahren. Du liebst ihn und er liebt dich, was zur Hölle ist dein Problem?“
„Was mein Problem ist?“ Meine Hände ballten sich zu so festen Fäusten, dass meine Unterarme zu zittern begannen. „Mein Problem ist, dass mich scheinbar jeder für zu blöd hält, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und wenn du schon hinter meinem Rücken für mich entscheidest, dann erweis mir wenigstens so viel Respekt und steh dazu und verkriech dich nicht feige, wenn dein Verhalten Konsequenzen zieht. Oder konntest du etwa den unglücklichen Blick deiner Cousine nicht ertragen, als sie zum Altar schritt?“ Meine Stimme war pures Gift und Edward zuckte merklich zusammen. Natürlich hatte Edward recht und die Hochzeit war das Beste für mich und das Kind gewesen. Was allerdings das Beste für Thomas gewesen wäre, das stand auf einem ganz anderen Blatt und würde mich ein Leben lang quälen. Und nichts desto trotz hätte Edward da sein müssen, um mir Kraft zu geben. Das wäre er mir schuldig gewesen.
„Ich hatte wirklich nur gute Absichten, Anni. Das musst du mir glauben.“ Flehend sah Edward mich an und für einen Moment war ich versucht ihm zu verzeihen, doch dieser Moment wehrte nur kurz. Nicht ein Wort der Entschuldigung war über seine Lippen gekommen, nicht eine Bitte des Verzeihens. Mein Mann war so eben in den Krieg gezogen und vielleicht war ich bald schon eine Witwe. Eine Ungewissheit, die sich wie ein Messer in mein Herz und meine Seele bohrte.
„Der Weg zu Hölle ist mit guten Absichten gepflastert, Edward.“ Noch während ich die Worte aussprach, taten sie mir auch schon leid, doch sie linderten nicht meine Wut. Ich drehte mich auf dem Absatz um und lief fast zu den großen Flügeltüren ins Freie, ohne mich auch noch einmal umzusehen.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 5 Part 2
Der Herbst kam mit großen Schritten und ich verfiel in eine tiefe Lethargie. Das Haus verließ ich nur noch, um gemeinsam mit meiner Familie zur Kirche zu gehen. Nur dann und bei den gemeinsamen Mahlzeiten sah ich Edward. Meine Worte hatten ihn zutiefst verletzt, dass konnte ich spüren und auch sehen, wann immer unsere Blicke sich flüchtig kreuzten. Meine Wut auf ihn war genauso stark wie meine Sehnsucht nach dem, was uns einmal verbunden hatte. Vertrauen und Zuneigung. Eine Seele in zwei Körpern. Oft nahm ich mir vor, ihn zu suchen und mit ihm zu reden. Ihm zu sagen, dass ich ihm verzeihe, doch ich tat es nie. Tag täglich versteckte ich mich, schlimmer noch als je zuvor hinter meinen Büchern und lebte nur noch für die wenigen Briefe von Thomas die mich dann und wann erreichten.
Meinen 17. Geburtstag, im Dezember feierte ich nur halbherzig mit Mary, Georgia und Sophia und auch nur, weil meine Tante diese eingeladen hatte. Sie war der Meinung, dass es auf keinen Fall gut für mich und das Kind sein könnte, wenn ich den ganzen Tag nur Trübsal blies und das ich einfach etwas Ablenkung bräuchte. Natürlich war es vor meiner Tante nicht verborgen geblieben, welche tiefe Kluft sich zwischen mir und Edward ausgebreitet hatte, doch auch hier war sie guter Dinge, dass die Zeit schon alles wieder heil machen würde. Sie war eine ewige Optimistin, doch in diesem Fall hoffte ich, dass sie recht haben möge.
Und so saß ich bei Gebäck und Tee mit den Mädchen zusammen und hörte mir ihre Geschichten vom Leben an. Georgia hatte sich inzwischen tatsächlich gegen ihre Mutter durchgesetzt und war Schwesternschülerin geworden, während Mary und Sophia ihren Collegebesuch für das nächste Jahr planten. In der Hoffnung, ihre Freude würde auf mich übergeben, ließ ich den Nachmittag an mir vorüberziehen, aber nichts geschah. Das Gefühl in meiner Brust war immer noch genauso leer wie zuvor. Vielleicht sogar noch ein wenig leerer, weil ich neidisch war auf die Unbekümmertheit meiner Freundinnen.
Dennoch verursachte die Sorge, im Blick meiner Tante ein Einsehen in mir und ich versuchte zumindest, mich wieder ein wenig in den Alltag einzufügen. Allen Bemühungen zum Trotz konnte ich aber weder am Christ- noch am Neujahrsfest wirkliche Freude empfinden. Meine Schwangerschaft war nun für jeden deutlich sichtbar und das Gerede nahm noch einmal zu. Außer Mary gossen sämtliche Mitglieder meiner angeheirateten Familie ordentlich Öl ins Feuer und zogen über mich her, als sei ich die schlimmste Hure, die Chicago jemals hervor gebracht hatte. Es war ganz sicher kein Zufall, dass der Pastor an einem Sonntag Ende Januar, eine lange Liturgie über die Sünde Evas anstimmte und dabei nur zu deutlich in meine Richtung sah. Alle Frauen seien Sünderinnen sagte er, denn wir seien Evas Töchter und Gott bestrafe die Sünder nicht nur im Jenseits, sondern bereits im Leben.
Ich verließ die Kirche an diesem Tag mit Magenschmerzen und entschuldigte mich deshalb vom Mittagessen, um mich stattdessen lieber etwas hinzulegen. Seufzend legte ich mich auf das frisch gemacht Bett, faltete die Hände über meinem runden Bauch und sah an die Decke. Dann begann ich zu beten, in der Hoffnung Gott könne mir meinen Sündenfall verzeihen und mich wenigstens im Diesseits schonen. Ich bete bis ich einschlief und mich wieder dieser seltsame Traum einholte, den ich bereits in der Nacht vor Thomas´ Abreise gehabt hatte. Aber dieses Mal war er anders. Anstelle meines Spiegelbildes sah ich wieder Thomas, diesmal aber mehr als nur eine Spiegelung seines Gesichts. Er selbst war vor mir im Wasser und ruderte wild mit dem Armen. Immer wieder ging er unter um dann prustend wieder durch die rote Wasseroberfläche zu stoßen. Er war am ertrinken. Hysterisch schrie ich nach ihm und versuchte ihm meine Hand zu reichen, doch wann immer ich nach ihm greifen wollte, wurde er in die Tiefe gerissen und tauchte schließlich nicht wieder auf.
Schreiend erwachte ich aus diesem Albtraum und musste feststellen, dass ich am ganzen Leib zitterte, obwohl meine Stirn von einem dünnen Schweißfilm benetzt war. Mein Atem ging schnell als ich mich aufrichtete und mit dem Ärmel über meine Stirn wischte. Unter meinem Herzen strampelte mein ungeborenes Kind, als hätte es alles von diesem schrecklichen Traum miterlebt. „Nur ein Traum. Nur ein Traum. Das war nur ein Traum, Joanna.“ Ich versuchte mich zu beruhigen, doch es gelang mir nicht. Ich war völlig aufgewühlt. Eine seltsame Vorahnung überkam mich, die etwas mit der Predigt und dem Traum zu tun hatte, aber ich konnte sie nicht so recht deuten.
Eilig richtete ich meine Erscheinung und stieg dann die Treppe hinab ins Erdgeschoss. Bereits auf dem ersten Treppenabsatz hörte ich eine leise Melodie die Flure des großen Hauses erfüllen. Es war Edward, der Klavier spielte. Das hatte er wahrlich lange nicht mehr getan. Mit immer noch zitternden Händen öffnete ich die Tür zum Salon und trat ein. Sofort erstarb das Klavierspiel und die Augen meiner Tante, meines Onkels und meines Cousins waren auf mich gerichtet. Ich versuchte zu lächeln. Lange Zeit hatte ich solch familiären Nachmittagen nicht mehr beigewohnt, doch jetzt erschien es mir wichtig, die Nähe der Menschen zu suchen, die mich immer geliebt hatten. „Spiel doch bitte weiter, Edward“, bat ich meinen Cousin und strich ihm im vorbeigehen flüchtig über die Schulter, bevor ich neben meiner Tante auf dem Sofa Platz nahm. Edward wartete bis ich saß und sah mich dabei unverhohlen an. Eine Mischung von Gefühlen lag in seinem Blick. Allem voran Freude, dass ich nach so langer Zeit des Schweigens endlich wieder das Wort an ihn gerichtet hatte.
Er spielte ein fröhliches Lied, das mein Herz nicht erreichte. Damals wusste ich noch nicht was es war, das mich so schwermütig machte. Ein Lächeln umspielte auch die Züge meiner Tante, die die Hand ihres Gatten ergriffen hatte und konzentriert dem Spiel ihres Sohnes lauschte. Und so saßen wir einfach da, im völligen Einklang und zufrieden mit dem was wir hatten ohne Zorn über das was geschehen war, bis es plötzlich an der Tür klopfte und Sidonie eintrat. „Da… äh… da ist Besuch für sie… Joanna“, kündigte sie an und wirkte dabei überaus nervös, ganz im Gegenteil zu mir. Mein Herz, das kaum eine Stunde zuvor noch gedroht hatte aus meiner Brust zu springen, schlug nun ganz ruhig und regelmäßig. Ich wusste, was kommen würde.
„Dann lass ihn doch eintreten, Sidonie“, nahm mein Onkel mir vorweg und erhob sich. Er wusste nicht, was kommen würde. Das Hausmädchen nickte eilig und trat beiseite, damit der junge Soldat den Salon betreten konnte.
„Guten Abend.“ Sein Gruß war höfflich, aber in keinster Weise herzlich. Er hielt seinen Hut zwischen den langen schmalen Fingern und drehte ihn in einem fort hin und her, als könnte er seiner Unsicherheit so besser Herr werden. „Bitte entschuldigen sie diese sonntagliche Störung, aber ich komme in einer Sache, die keinen Aufschub duldet.“
„Schlechte Nachrichten?“, fragte mein Onkel und seine Miene verfinsterte sich. Ich schloss kurz die Augen und atmete tief durch, um mich zu wappnen.
„Es kam zu einem Gefecht auf französischem Gebiet gegen die Deutschen. Private Sommers wurde an der Schulter verletzt und sollte auf einem Lazarettschiff zurück nach England gebracht werden.“ Der Soldat stockte kurz und sein Blick fiel auf meinen Bauch, auf dem ich meine rechte Hand abgelegt hatte. „Dass Schiff wurde von einem deutschen U-Boot angegriffen und sank.“ Betroffen senkte er seinen Blick. Ein laut des Entsetzens ging von meiner Tante aus, die eine Hand vor den Mund schlug.
Und auf einmal ergab für mich alles einen Sinn. Die Predigt und der Traum. Thomas war ertrunken, als Strafe für meine Sünden. Ohne ein Wort erhob ich mich vom Sofa und stellte mich auf meine wackeligen Beine. „Ich danke ihnen, dass sie gekommen sind.“ Meine Stimme klang merkwürdig fern, als befände ich mich selbst unter Wasser. „Das war sicher keine leichte Aufgabe für Sie.“ Ich reichte dem Gefreiten die Hand und schüttelte sie, dann ging ich an ihm vorbei auf den Flur, wo ich ohnmächtig wurde.
Meinen 17. Geburtstag, im Dezember feierte ich nur halbherzig mit Mary, Georgia und Sophia und auch nur, weil meine Tante diese eingeladen hatte. Sie war der Meinung, dass es auf keinen Fall gut für mich und das Kind sein könnte, wenn ich den ganzen Tag nur Trübsal blies und das ich einfach etwas Ablenkung bräuchte. Natürlich war es vor meiner Tante nicht verborgen geblieben, welche tiefe Kluft sich zwischen mir und Edward ausgebreitet hatte, doch auch hier war sie guter Dinge, dass die Zeit schon alles wieder heil machen würde. Sie war eine ewige Optimistin, doch in diesem Fall hoffte ich, dass sie recht haben möge.
Und so saß ich bei Gebäck und Tee mit den Mädchen zusammen und hörte mir ihre Geschichten vom Leben an. Georgia hatte sich inzwischen tatsächlich gegen ihre Mutter durchgesetzt und war Schwesternschülerin geworden, während Mary und Sophia ihren Collegebesuch für das nächste Jahr planten. In der Hoffnung, ihre Freude würde auf mich übergeben, ließ ich den Nachmittag an mir vorüberziehen, aber nichts geschah. Das Gefühl in meiner Brust war immer noch genauso leer wie zuvor. Vielleicht sogar noch ein wenig leerer, weil ich neidisch war auf die Unbekümmertheit meiner Freundinnen.
Dennoch verursachte die Sorge, im Blick meiner Tante ein Einsehen in mir und ich versuchte zumindest, mich wieder ein wenig in den Alltag einzufügen. Allen Bemühungen zum Trotz konnte ich aber weder am Christ- noch am Neujahrsfest wirkliche Freude empfinden. Meine Schwangerschaft war nun für jeden deutlich sichtbar und das Gerede nahm noch einmal zu. Außer Mary gossen sämtliche Mitglieder meiner angeheirateten Familie ordentlich Öl ins Feuer und zogen über mich her, als sei ich die schlimmste Hure, die Chicago jemals hervor gebracht hatte. Es war ganz sicher kein Zufall, dass der Pastor an einem Sonntag Ende Januar, eine lange Liturgie über die Sünde Evas anstimmte und dabei nur zu deutlich in meine Richtung sah. Alle Frauen seien Sünderinnen sagte er, denn wir seien Evas Töchter und Gott bestrafe die Sünder nicht nur im Jenseits, sondern bereits im Leben.
Ich verließ die Kirche an diesem Tag mit Magenschmerzen und entschuldigte mich deshalb vom Mittagessen, um mich stattdessen lieber etwas hinzulegen. Seufzend legte ich mich auf das frisch gemacht Bett, faltete die Hände über meinem runden Bauch und sah an die Decke. Dann begann ich zu beten, in der Hoffnung Gott könne mir meinen Sündenfall verzeihen und mich wenigstens im Diesseits schonen. Ich bete bis ich einschlief und mich wieder dieser seltsame Traum einholte, den ich bereits in der Nacht vor Thomas´ Abreise gehabt hatte. Aber dieses Mal war er anders. Anstelle meines Spiegelbildes sah ich wieder Thomas, diesmal aber mehr als nur eine Spiegelung seines Gesichts. Er selbst war vor mir im Wasser und ruderte wild mit dem Armen. Immer wieder ging er unter um dann prustend wieder durch die rote Wasseroberfläche zu stoßen. Er war am ertrinken. Hysterisch schrie ich nach ihm und versuchte ihm meine Hand zu reichen, doch wann immer ich nach ihm greifen wollte, wurde er in die Tiefe gerissen und tauchte schließlich nicht wieder auf.
Schreiend erwachte ich aus diesem Albtraum und musste feststellen, dass ich am ganzen Leib zitterte, obwohl meine Stirn von einem dünnen Schweißfilm benetzt war. Mein Atem ging schnell als ich mich aufrichtete und mit dem Ärmel über meine Stirn wischte. Unter meinem Herzen strampelte mein ungeborenes Kind, als hätte es alles von diesem schrecklichen Traum miterlebt. „Nur ein Traum. Nur ein Traum. Das war nur ein Traum, Joanna.“ Ich versuchte mich zu beruhigen, doch es gelang mir nicht. Ich war völlig aufgewühlt. Eine seltsame Vorahnung überkam mich, die etwas mit der Predigt und dem Traum zu tun hatte, aber ich konnte sie nicht so recht deuten.
Eilig richtete ich meine Erscheinung und stieg dann die Treppe hinab ins Erdgeschoss. Bereits auf dem ersten Treppenabsatz hörte ich eine leise Melodie die Flure des großen Hauses erfüllen. Es war Edward, der Klavier spielte. Das hatte er wahrlich lange nicht mehr getan. Mit immer noch zitternden Händen öffnete ich die Tür zum Salon und trat ein. Sofort erstarb das Klavierspiel und die Augen meiner Tante, meines Onkels und meines Cousins waren auf mich gerichtet. Ich versuchte zu lächeln. Lange Zeit hatte ich solch familiären Nachmittagen nicht mehr beigewohnt, doch jetzt erschien es mir wichtig, die Nähe der Menschen zu suchen, die mich immer geliebt hatten. „Spiel doch bitte weiter, Edward“, bat ich meinen Cousin und strich ihm im vorbeigehen flüchtig über die Schulter, bevor ich neben meiner Tante auf dem Sofa Platz nahm. Edward wartete bis ich saß und sah mich dabei unverhohlen an. Eine Mischung von Gefühlen lag in seinem Blick. Allem voran Freude, dass ich nach so langer Zeit des Schweigens endlich wieder das Wort an ihn gerichtet hatte.
Er spielte ein fröhliches Lied, das mein Herz nicht erreichte. Damals wusste ich noch nicht was es war, das mich so schwermütig machte. Ein Lächeln umspielte auch die Züge meiner Tante, die die Hand ihres Gatten ergriffen hatte und konzentriert dem Spiel ihres Sohnes lauschte. Und so saßen wir einfach da, im völligen Einklang und zufrieden mit dem was wir hatten ohne Zorn über das was geschehen war, bis es plötzlich an der Tür klopfte und Sidonie eintrat. „Da… äh… da ist Besuch für sie… Joanna“, kündigte sie an und wirkte dabei überaus nervös, ganz im Gegenteil zu mir. Mein Herz, das kaum eine Stunde zuvor noch gedroht hatte aus meiner Brust zu springen, schlug nun ganz ruhig und regelmäßig. Ich wusste, was kommen würde.
„Dann lass ihn doch eintreten, Sidonie“, nahm mein Onkel mir vorweg und erhob sich. Er wusste nicht, was kommen würde. Das Hausmädchen nickte eilig und trat beiseite, damit der junge Soldat den Salon betreten konnte.
„Guten Abend.“ Sein Gruß war höfflich, aber in keinster Weise herzlich. Er hielt seinen Hut zwischen den langen schmalen Fingern und drehte ihn in einem fort hin und her, als könnte er seiner Unsicherheit so besser Herr werden. „Bitte entschuldigen sie diese sonntagliche Störung, aber ich komme in einer Sache, die keinen Aufschub duldet.“
„Schlechte Nachrichten?“, fragte mein Onkel und seine Miene verfinsterte sich. Ich schloss kurz die Augen und atmete tief durch, um mich zu wappnen.
„Es kam zu einem Gefecht auf französischem Gebiet gegen die Deutschen. Private Sommers wurde an der Schulter verletzt und sollte auf einem Lazarettschiff zurück nach England gebracht werden.“ Der Soldat stockte kurz und sein Blick fiel auf meinen Bauch, auf dem ich meine rechte Hand abgelegt hatte. „Dass Schiff wurde von einem deutschen U-Boot angegriffen und sank.“ Betroffen senkte er seinen Blick. Ein laut des Entsetzens ging von meiner Tante aus, die eine Hand vor den Mund schlug.
Und auf einmal ergab für mich alles einen Sinn. Die Predigt und der Traum. Thomas war ertrunken, als Strafe für meine Sünden. Ohne ein Wort erhob ich mich vom Sofa und stellte mich auf meine wackeligen Beine. „Ich danke ihnen, dass sie gekommen sind.“ Meine Stimme klang merkwürdig fern, als befände ich mich selbst unter Wasser. „Das war sicher keine leichte Aufgabe für Sie.“ Ich reichte dem Gefreiten die Hand und schüttelte sie, dann ging ich an ihm vorbei auf den Flur, wo ich ohnmächtig wurde.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 6 Part 1
*Rückblick*
*Rückblick*
Als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett und schwaches Mondlicht drang durch die Fenster. Vorsichtig versuchte ich mich aufzurichten, was gar nicht so einfach war, da jemand meinen Körper fest in mehrere Decken gehüllt hatte. Irgendwie gelang es mir aber doch eine Hand aus den vielen Lagen von Baumwolle zu befreien. Wenig kraftvoll presste ich die Fingerspitzen gegen meine Schläfe, hinter denen es schmerzhaft poste. Wie lange ich wohl bewusstlos gewesen war?
Leises, gleichmäßiges atmen, ging von einer Person aus, die nicht weit von meinem Bett entfernt in einem Lehnstuhl saß und der schwarzen Silhouette nach zu urteilen Edward war. Für einen kurzen Moment stieg die Versuchung in mir auf, mich aus dem Bett zu rappeln und mich an seine Brust zu schmeißen, um all den Schmerz aus meiner Seele zu weinen. Doch ich wusste, dass es nichts helfen würde. Es würde nichts besser machen. Nicht im Geringsten, denn ich war mir zwei Dingen vollkommen bewusst. Thomas war tot. Er war unwiederbringlich von dieser Welt verschwunden und den Schmerz über diesen Verlust würde ich ein Leben lang mit mir umher tragen. Und der Grund dafür war ich. Es war Gottes Strafe für meine unverzeihliche Sünde. Für meine Hemmungslosigkeit genauso wie für meine Schamlosigkeit. Für meine Wollust ebenso wie für meine Gier.
Ich hatte es gewusst. Ich hatte die ganze Zeit über gewusst, dass Gott mich für diesen Fehler bestrafen würde. Genau deshalb hatte ich Thomas nichts sagen wollen. Ich hatte niemals gewollt, dass es soweit käme. Deshalb war ich auch so wütend auf Edward gewesen.
Vorsichtig beugte ich mich zu ihm herüber und spielte mit dem Gedanken ihn zu wecken, um mich bei ihm zu entschuldigen. Er hatte meine Wut nicht verdient, denn er hatte wirklich nur mein Bestes gewollt. Wie hätte er denn meinen Zorn auch verstehen können, wo mir doch gerade erst selbst bewusst geworden war, was mein Herz so lange schon vermutet hatte. Aber hätte Edward mir geglaubt, wenn ich ihm von meinen Träumen und Vorahnungen erzählt hätte? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte er es auf den Schock geschoben oder gedacht ich würde durchdrehen. Und wenn ich schon nicht damit rechnete, dass mein Cousin mir glaubte, so brauchte ich auf das Verständnis der anderen gar nicht erst zu hoffen.
Ich musste es nehmen wie es war. Gott hatte seine Strafe genau so geplant, wie sie gekommen war. Ich musste sie akzeptieren und dankbar sein, dass es mir und dem Kind gut ging. Dankbar dafür, das der Allmächtige mir und meinem Gatten immerhin ein paar Tage in trauter Zweisamkeit geschenkt hatte, auch wenn ich diese, meiner Vorahnungen wegen nicht wirklich hatte genießen können. Ja, ich hätte dankbar sein sollen, doch ich konnte nicht. Sehnlichst wünschte ich mir, dass wenigstens ich es gewesen wäre, die als Vergeltung für den Sündenfall gestorben wäre und nicht Thomas. Ein leises Schluchzen schlich sich über meine Lippen und Edward zuckte merklich zusammen. Ich konnte schemenhaft erkennen, wie er seine Augen öffnete, die grün blitzten, als wäre er eine Katze.
„Anni“, flüsterte er heiser meinen Namen und ein kalter Schauer lief über meinen Rücken. Trotz der rüden Behandlung die ich ihm in den letzten Monaten hatte zukommen lassen, schwang nichts als Liebe und Verständnis in seiner Stimme. Mit einer fließenden Bewegung erhob er sich aus dem Stuhl, nur um sich direkt wieder neben mir auf dem Bett nieder zu lassen. Fest und tröstlich legten sich seine starken Arme, die schon lange nicht mehr die Arme eines Kindes waren um mich. Wie hatte ich nur jemals so wütend auf ihn sein können, so ungerecht und gemein? Die ersten Tränen stahlen sich aus meinen Augenliedern und wie damals auf der Treppe, begann Edward mich zärtlich hin und her zu wiegen. „Es tut mir leid, Anni“, flüsterte er leise in mein Ohr, während sein Kinn auf meiner bebenden Schulter ruhte.
„Nein, Edward.“ Ich versuchte mit dem Kopf zu schütteln, was mir nicht so ganz gelang. „MIR tut es leid!“ Und das tat es wirklich. Es tat mir leid, dass ich mich der Sünde hingegeben hatte, das Thomas deswegen gestorben war und das ich Edward dafür auch noch mit Nichtachtung gestraft hatte. Ich war ein schlechter Mensch und hatte die Schmerzen verdient die mein Herz heimsuchten. Was ich damals allerdings nicht ahnte war, dass Gott noch lange nicht damit fertig war mich zu bestrafen.
Natürlich war ich nicht die einzige, die Thomas´ Tod ein Loch in die Brust riss. Ich sah meine Tante mehr als eine Träne aus dem Augenwinkel wischen wann immer sie mich sah und auch mein Onkel schien ungewöhnlich bestürzt. Dafür, dass er selten ein gutes Haar an meinem Ehemann gelassen hatte, war er ganz schön blass um die Nase. Mary trug natürlich sehr schwer an dem Ableben ihres Bruders. Sie kam mich nahezu täglich besuchen und wann immer sie da war, saßen wir gemeinsam auf dem Sofa und hielten uns bei den Händen, während sie weinte und ich versuchte genau dies nicht zu tun, sondern das Urteil des Herrn hinzunehmen.
Doch niemand litt so sehr unter dem Verlust, wie Thomas´ Mutter. Und das war einer der Gründe, warum Mary wann immer es ging zu mir kam. Misses Sommers heulte und schrie, fluchte und weinte dann wieder. Es war ein Bild des Jammers, das ich so noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Als ich es nach zwei Tagen endlich über mich brachte, zu den Sommers´ zu gehen, um ihnen mein Beileid auszusprechen, warf sie mit einer Vase nach mir und nannte mich eine Hexe.
Zwei Wochen lang versuchten Mary und ihr Vater alles nur erdenkliche, um sie zu besänftigen, doch es schien keinen Trost für sie zu geben. Ihr Schmerz war so groß, dass sie den Verstand verlor und ihr Mann sie schließlich nach Oregon brachte, wo seine Schwester ein Sanatorium leitete. Es war eine Tragödie, wie Shakespeer selbst sie sich nicht hätte ausdenken können. Doch der letzte Akt war noch in weiter Ferne. Mary schlug die Verzweiflung über den Verlust des Bruders und der Mutter, sowie die lange Abwesenheit ihres Vaters mächtig auf den Appetit und binnen weniger Wochen wurde aus dem pummeligen, fröhlichen Mädchen eine ernste, stille und vor allem magere junge Frau. So machtlos habe ich mich noch nie zuvor in meinem Leben gefühlt. Es war doch nur ein einziger Sommertag gewesen, in dem ich alle Züchtigkeiten vergessen hatte, der nun die Menschen um mich herum in kollektives Unglück stürzen lies. All meine Bemühungen Trost zu spenden nützen nichts und als schließlich auch noch mein Onkel erkrankte, gingen mir die guten Worte aus. Ich war am Ende meiner Kräfte angekommen.
Es geschah im April des Jahres 1918. Über Nacht bekam er plötzlich hohes Fieber, das seinen massigen Körper mit starkem Schüttelfrost quälte. Zwei Tage und Nächte lange mühten meine Tante und ich uns ab, es mit Wadenwinkeln zu senken, doch es schien stündlich schlimmer zu werden. Als wir schließlich nach dem Arzt schickten, konnte ich mich kaum noch auf den Beinen halten, die ohnehin geschwollen waren, als würden sie nicht zu mir sondern zu einer Elefantenkuh gehören. Der Medicus warf einen kurzen Blick auf den Patienten und sagte dann zwei Worte, die wie ein Echo durch den Raum hallten und allen dem Atem verschlug: „Spanische Grippe“.
Wir hatten bereits von dieser Krankheit gehört, die sich in anderen Staaten wie ein Lauffeuer verbreitete, doch in unserer tiefen Trauer, hatten wir diesem aktuellen Thema kaum Beachtung geschenkt. Die Leute starben wie die Fliegen hieß es in den Zeitungen und nun schien die Krankheit also auch hier angekommen zu sein. Entsetzt sah ich von meiner Tante zu Edward, dann zu Mary und schließlich zu Sidonie, die sich verängstigt am Türrahmen festhielt. „Ich bin seid drei Tagen auf den Beinen“, klagte der Arzt und seufzte laut. „Sie hatten Glück, dass sie mich überhaupt angetroffen haben. Die Krankenhäuser platzen aus allen Nähten. Diese Krankheit ist eine Seuche.“ Kopfschütteln kratzte sich der Mann an der unrasierten Wange. „Er muss sofort ins Krankenhaus. Am besten bringen sie ihn ins Trinity Hospital, dort wird man ihm Medikamente geben. Beten kann auch nicht schaden.“ Verzweifelt sah der Arzt noch einmal in Runde, dann nahm er seinen Hut, nickte zum Abschied und verschwand.
Leises, gleichmäßiges atmen, ging von einer Person aus, die nicht weit von meinem Bett entfernt in einem Lehnstuhl saß und der schwarzen Silhouette nach zu urteilen Edward war. Für einen kurzen Moment stieg die Versuchung in mir auf, mich aus dem Bett zu rappeln und mich an seine Brust zu schmeißen, um all den Schmerz aus meiner Seele zu weinen. Doch ich wusste, dass es nichts helfen würde. Es würde nichts besser machen. Nicht im Geringsten, denn ich war mir zwei Dingen vollkommen bewusst. Thomas war tot. Er war unwiederbringlich von dieser Welt verschwunden und den Schmerz über diesen Verlust würde ich ein Leben lang mit mir umher tragen. Und der Grund dafür war ich. Es war Gottes Strafe für meine unverzeihliche Sünde. Für meine Hemmungslosigkeit genauso wie für meine Schamlosigkeit. Für meine Wollust ebenso wie für meine Gier.
Ich hatte es gewusst. Ich hatte die ganze Zeit über gewusst, dass Gott mich für diesen Fehler bestrafen würde. Genau deshalb hatte ich Thomas nichts sagen wollen. Ich hatte niemals gewollt, dass es soweit käme. Deshalb war ich auch so wütend auf Edward gewesen.
Vorsichtig beugte ich mich zu ihm herüber und spielte mit dem Gedanken ihn zu wecken, um mich bei ihm zu entschuldigen. Er hatte meine Wut nicht verdient, denn er hatte wirklich nur mein Bestes gewollt. Wie hätte er denn meinen Zorn auch verstehen können, wo mir doch gerade erst selbst bewusst geworden war, was mein Herz so lange schon vermutet hatte. Aber hätte Edward mir geglaubt, wenn ich ihm von meinen Träumen und Vorahnungen erzählt hätte? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte er es auf den Schock geschoben oder gedacht ich würde durchdrehen. Und wenn ich schon nicht damit rechnete, dass mein Cousin mir glaubte, so brauchte ich auf das Verständnis der anderen gar nicht erst zu hoffen.
Ich musste es nehmen wie es war. Gott hatte seine Strafe genau so geplant, wie sie gekommen war. Ich musste sie akzeptieren und dankbar sein, dass es mir und dem Kind gut ging. Dankbar dafür, das der Allmächtige mir und meinem Gatten immerhin ein paar Tage in trauter Zweisamkeit geschenkt hatte, auch wenn ich diese, meiner Vorahnungen wegen nicht wirklich hatte genießen können. Ja, ich hätte dankbar sein sollen, doch ich konnte nicht. Sehnlichst wünschte ich mir, dass wenigstens ich es gewesen wäre, die als Vergeltung für den Sündenfall gestorben wäre und nicht Thomas. Ein leises Schluchzen schlich sich über meine Lippen und Edward zuckte merklich zusammen. Ich konnte schemenhaft erkennen, wie er seine Augen öffnete, die grün blitzten, als wäre er eine Katze.
„Anni“, flüsterte er heiser meinen Namen und ein kalter Schauer lief über meinen Rücken. Trotz der rüden Behandlung die ich ihm in den letzten Monaten hatte zukommen lassen, schwang nichts als Liebe und Verständnis in seiner Stimme. Mit einer fließenden Bewegung erhob er sich aus dem Stuhl, nur um sich direkt wieder neben mir auf dem Bett nieder zu lassen. Fest und tröstlich legten sich seine starken Arme, die schon lange nicht mehr die Arme eines Kindes waren um mich. Wie hatte ich nur jemals so wütend auf ihn sein können, so ungerecht und gemein? Die ersten Tränen stahlen sich aus meinen Augenliedern und wie damals auf der Treppe, begann Edward mich zärtlich hin und her zu wiegen. „Es tut mir leid, Anni“, flüsterte er leise in mein Ohr, während sein Kinn auf meiner bebenden Schulter ruhte.
„Nein, Edward.“ Ich versuchte mit dem Kopf zu schütteln, was mir nicht so ganz gelang. „MIR tut es leid!“ Und das tat es wirklich. Es tat mir leid, dass ich mich der Sünde hingegeben hatte, das Thomas deswegen gestorben war und das ich Edward dafür auch noch mit Nichtachtung gestraft hatte. Ich war ein schlechter Mensch und hatte die Schmerzen verdient die mein Herz heimsuchten. Was ich damals allerdings nicht ahnte war, dass Gott noch lange nicht damit fertig war mich zu bestrafen.
Natürlich war ich nicht die einzige, die Thomas´ Tod ein Loch in die Brust riss. Ich sah meine Tante mehr als eine Träne aus dem Augenwinkel wischen wann immer sie mich sah und auch mein Onkel schien ungewöhnlich bestürzt. Dafür, dass er selten ein gutes Haar an meinem Ehemann gelassen hatte, war er ganz schön blass um die Nase. Mary trug natürlich sehr schwer an dem Ableben ihres Bruders. Sie kam mich nahezu täglich besuchen und wann immer sie da war, saßen wir gemeinsam auf dem Sofa und hielten uns bei den Händen, während sie weinte und ich versuchte genau dies nicht zu tun, sondern das Urteil des Herrn hinzunehmen.
Doch niemand litt so sehr unter dem Verlust, wie Thomas´ Mutter. Und das war einer der Gründe, warum Mary wann immer es ging zu mir kam. Misses Sommers heulte und schrie, fluchte und weinte dann wieder. Es war ein Bild des Jammers, das ich so noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Als ich es nach zwei Tagen endlich über mich brachte, zu den Sommers´ zu gehen, um ihnen mein Beileid auszusprechen, warf sie mit einer Vase nach mir und nannte mich eine Hexe.
Zwei Wochen lang versuchten Mary und ihr Vater alles nur erdenkliche, um sie zu besänftigen, doch es schien keinen Trost für sie zu geben. Ihr Schmerz war so groß, dass sie den Verstand verlor und ihr Mann sie schließlich nach Oregon brachte, wo seine Schwester ein Sanatorium leitete. Es war eine Tragödie, wie Shakespeer selbst sie sich nicht hätte ausdenken können. Doch der letzte Akt war noch in weiter Ferne. Mary schlug die Verzweiflung über den Verlust des Bruders und der Mutter, sowie die lange Abwesenheit ihres Vaters mächtig auf den Appetit und binnen weniger Wochen wurde aus dem pummeligen, fröhlichen Mädchen eine ernste, stille und vor allem magere junge Frau. So machtlos habe ich mich noch nie zuvor in meinem Leben gefühlt. Es war doch nur ein einziger Sommertag gewesen, in dem ich alle Züchtigkeiten vergessen hatte, der nun die Menschen um mich herum in kollektives Unglück stürzen lies. All meine Bemühungen Trost zu spenden nützen nichts und als schließlich auch noch mein Onkel erkrankte, gingen mir die guten Worte aus. Ich war am Ende meiner Kräfte angekommen.
Es geschah im April des Jahres 1918. Über Nacht bekam er plötzlich hohes Fieber, das seinen massigen Körper mit starkem Schüttelfrost quälte. Zwei Tage und Nächte lange mühten meine Tante und ich uns ab, es mit Wadenwinkeln zu senken, doch es schien stündlich schlimmer zu werden. Als wir schließlich nach dem Arzt schickten, konnte ich mich kaum noch auf den Beinen halten, die ohnehin geschwollen waren, als würden sie nicht zu mir sondern zu einer Elefantenkuh gehören. Der Medicus warf einen kurzen Blick auf den Patienten und sagte dann zwei Worte, die wie ein Echo durch den Raum hallten und allen dem Atem verschlug: „Spanische Grippe“.
Wir hatten bereits von dieser Krankheit gehört, die sich in anderen Staaten wie ein Lauffeuer verbreitete, doch in unserer tiefen Trauer, hatten wir diesem aktuellen Thema kaum Beachtung geschenkt. Die Leute starben wie die Fliegen hieß es in den Zeitungen und nun schien die Krankheit also auch hier angekommen zu sein. Entsetzt sah ich von meiner Tante zu Edward, dann zu Mary und schließlich zu Sidonie, die sich verängstigt am Türrahmen festhielt. „Ich bin seid drei Tagen auf den Beinen“, klagte der Arzt und seufzte laut. „Sie hatten Glück, dass sie mich überhaupt angetroffen haben. Die Krankenhäuser platzen aus allen Nähten. Diese Krankheit ist eine Seuche.“ Kopfschütteln kratzte sich der Mann an der unrasierten Wange. „Er muss sofort ins Krankenhaus. Am besten bringen sie ihn ins Trinity Hospital, dort wird man ihm Medikamente geben. Beten kann auch nicht schaden.“ Verzweifelt sah der Arzt noch einmal in Runde, dann nahm er seinen Hut, nickte zum Abschied und verschwand.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 6 Part 2
Reglos standen wir einige Augenblicke einfach nur da und es machte den Anschein, als würde sich niemand mehr trauen zu atmen. Es war meine Tante, die als erste aus ihrer Starre erwachte, kurz die Augen schloss und tief durchatmete, bevor sie zurück zu ihrer wohlorganisierten Haltung überging. „Edward, wir brauchen einen Wagen“, wies sie ihren Sohn an, der auf der Stelle das Zimmer verließ, als hätte er nur darauf gewartet endlich eine Anweisung dieser Art zu bekommen. „Mary, hilf mir meinen Mann anzuziehen. Sidonie, sobald wir weg sind, muss dieses Zimmer gereinigt werden und zwar mit richtig heißem Wasser. Die Laken und alles muss gekocht werden oder am besten gleich verbrannt. Ich will nicht, dass noch jemand krank wird. Sei nicht zimperlich. Hast du mich verstanden?“ Das Hausmädchen nickte zögerlich und machte sich auf den Weg zur Küche. „Und du.“ Der Blick meiner Tante fiel auf mich. Zögerlich sah sie von meinem Gesicht auf meinen Bauch und schloss wieder die Augen, als würde sie den Rat des Arztes befolgen und schnell ein Stoßgebet zum Himmel schicken. „Ich will, dass du auf der Stelle dieses Zimmer verlässt“, befahl sie mir, als sie die Augen wieder öffnete. „Zieh dein Kleid aus. Sidonie soll es auch kochen oder verbrennen oder was weiß ich. Wasch dich und zwar gründlich. Und du übernimmst den Teil mit dem beten!“ Mit dem ausgestreckten Zeigefinger deutete sie auf die Tür und ich hatte überhaupt keine andere Wahl, als ihrem Befehl Folge zu leisten.
So schnell es meine zitternden, schweren Beine zuließen ging ich hinunter in die Küche, zog mein Kleid aus und wusch mich so lange mit kochend heißem Wasser, bis meine Haut ganz rot und aufgedunsen war. Ich hörte die Haustür, als Edward zurück kam und schließlich lautes Gepolter auf der Treppe, als Mary, meine Tante und Edward meinen Onkel nach unten brachten. Dann ging wieder die Haustür und ich war mit Sidonie allein. „Miss?“, fragte sie vorsichtig, als ich gerade dabei war, mich mit einem Handtuch abzureiben. Da ich in meine Gedanken vertieft war, hatte ich gar nicht gemerkt, wie sie an mich heran getreten war und zuckte deshalb erschrocken zusammen. „Miss, darf ich?“ Ohne das ich wirklich wusste was sie eigentlich von mir wollte und ohne, das Sidonie meine Antwort abwartete, legte sie eine Hand an meine Stirn. Ich dachte schon, sie wollte fühlen ob ich ebenfalls Fieber hätte, doch ich täuschte mich. Leise begann sie etwas vor sich hin zu murmeln in einer Sprache, die ich nicht verstand, die aber angenehm beruhigend wirkte. Ich betrachtete die kleine Frau mit der dunklen Haut und den wilden schwarzen Locken verwundert, traute mich aber nicht etwas zu sagen. Es vergingen einige Sekunden, dann nahm sie ihre Hand wieder herunter und lächelte. „Das ist zum Schutz“, erklärte sie mir und wirkte ein wenig verlegen. „In Afrika machen das die Leute gegen Gefahr.“
Verblüfft riss ich die Augen auf. „Ähm… danke.“
Wieder lächelte sie mich an, dann griff sie nach dem Zinneimer in den sie das kochende Wasser gefüllt hatte und machte sich auf den Weg nach oben. Schwerfällig stieg ich in ein sauberes Kleid, das sie mir bereitgelegt hatte und ging durch den Flur in das Wohnzimmer. Auf eine sehr seltsame Art und Weise fühlte ich mich plötzlich wirklich sicher und mein Herz, das eben noch vor lauter Aufregung raste, schlug nun langsam und gleichmäßig. Sicheren Schrittes ging ich zu der Vitrine neben dem Sofa, öffnete die verglaste Tür und fand sofort wonach ich gesucht hatte. Ein kleines Kästchen aus dunklem Ebenholz. Vorsichtig nahm ich es heraus und setzte mich damit auf das Sofa. Als ich den kleinen silbernen Verschluss öffnete schnappte der Deckel auf und gab mir den Blick auf einen Rosenkranz aus dem gleichen dunklen Holz preis. Ich nahm die Kette in die Rechte. Das Kästchen legte ich neben mich auf das Polster. Die Perlen fühlten sich warm an, als ich sie durch meine Finger gleiten ließ, während ich leise anfing zu sprechen: „Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.“
Ich betete, während der Tag an mir vorüberzog. Ich betete und wartete, dass endlich meine Tante, Mary und Edward oder zumindest einer von ihnen heimkehren würde. Es dämmerte bereits, als ich die Haustür hörte. So schnell es mein schwerer Körper zuließ erhob ich mich und wollte in den Flur gehen, doch ein stechender Schmerz drückte mich umgehend zurück in die Polster. Ein lauter Schrei entfuhr mir, meine Hand verkrampfte sich um den Rosenkranz. Ich spürte eine warme Nässe meine Schenkel hinab laufen, als die Tür zum Salon aufflog und Mary, Edward und Sidonie herein stürmten. „Was ist passiert?“ Mit gehetztem Blick sah sich mein Cousin in dem Zimmer um, als erwartete er einem bewaffneten Einbrecher zu entdecken.
„Das…“ Ich japste nach Luft, als eine weitere Welle von Schmerzen durch meinen Körper rollte. „Das Baby“, stieß ich schließlich irgendwie hervor und kniff die Augen zusammen.
„Auch das noch“, nuschelte Mary.
„Ich… Oh verdammt“, fluchte Edward. „Der Wagen, er steht noch vor der Tür. Wir bringen dich ins Krankenhaus.“ Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich, dass er einen Schritt auf mich zu machen wollte, wahrscheinlich um mir auf zu helfen, aber Sidonie versperrte ihm den Weg.
„Sie können sie doch nicht in das Krankenhaus bringen wo all die kranken Leute sind“, blaffte sie ihn mit erstaunlich lauter Stimme an.
„Hast du eine bessere Idee?“ Edward schien ebenfalls völlig durcheinander über den plötzlich so bestimmenden Tonfall des Dienstmädchens.
„Sie bleibt hier. Niemand braucht einen Arzt um ein Kind zu bekommen und schon gar keine sterbenden Menschen um sich herum.“ Sidonie drehte sich zu mir um und griff nach meiner Hand, dann murmelte sie wieder etwas in ihrer Muttersprache. „Sie beide gehen in die Küche“, befahl sie sie Mary und Edward genau wie meine Tante es am Morgen noch getan hatte. „Waschen sie sich gründlich und heiß. Ich bringe Miss Anni nach oben. Wenn sie fertig sind kommen sie auch. Bringen sie heißes Wasser mit, Tücher und ein Messer.“ Vorsichtig zog sie meinen Arm hoch und legte ihn um ihre schmalen Schultern. Mit erstaunlicher Leichtigkeit zog sie mich auf die Füße und führte mich auf den Flur zur Treppe. „Alles wird gut. Ich hab schon viele Babys auf die Welt geholt.“ Wieder lächelte sie.
Ich wollte etwas erwidern, wollte ihr sagen, dass ich ihr glaubte und vertraute, doch mehr als ein leises Wimmern brachte ich nicht zur Stande. Die Treppe zu meinem Schlafzimmer war mir noch nie so hoch vorgekommen und die Stufen noch nie so zahlreich. Eine Wehe nach der anderen zog durch meinen Körper und ich hätte niemals vermutet, dass es noch schlimmer hätte werden können, doch es kam schlimmer. Ich verspürte eine kurze Erleichterung, als ich wir endlich mein Zimmer erreicht hatten und ich mich hinlegen konnte, doch dann wurden die Schmerzen richtig schlimm. Ich wollte pressen, das Kind aus meinem Körper schieben, doch Sidonie verbot es mir. „Noch nicht“, sagte sie bestimmend, nachdem sie meinen Rock hochgeschlagen und einen prüfenden Blick zwischen meine Beine geworfen hatte. Ich hätte wohl so etwas wie Scham empfinden sollen, doch in diesem Moment war mir alles egal. Ich wollte, dass der Schmerz endlich aufhörte. Mit all meiner Kraft drückte ich den Rosenkranz, den ich immer noch in meiner Hand hielt so fest, das ich das Holz splittern hören konnte.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange ich so da lag und schrie und versuchte zu atmen, während Sidonie immer wieder mit dem Kopf schüttelte und sagte „Noch nicht.“ Ich verstand einfach nicht wieso ich nicht pressen sollte. Dieses Kind wollte doch ganz offensichtlich heraus. Irgendwann klopfte es leise an der Tür und Mary trat ein. In den Händen hielt sie eine Schale dampfendes Wasser aus der, der Griff eines Messers ragte. Die weißen Handtücher hatte sie sich über den Arm gehangen. Sie stellte die Schüssel auf meinem Frisiertisch ab, die Tücher legte sie daneben. Dann wollte sie die Tür schließen, doch Sidonie war schneller.“Kommen sie rein!“, sagte sie barsch und verschwommen konnte ich erkennen, dass Edward auf dem Flur stand.
„Ich?“
„Stellen sie sich nicht so an!“ Sidonie machte zwei lange Schritte nach draußen und zerrte Edward dann am Arm in das Zimmer. „Halten sie ihre Hand!“ ordnete sie an und wies dann auf Mary. „Du hilfst mir hier.“
Was genau geschah kann ich nicht mehr sagen, aber Edward löste den Rosenkranz aus meinen schweißnassen Fingern und griff tatsächlich nach meiner Hand, während Mary und das Hausmädchen sich am Fußende des Bettes postierten. „Jetzt darfst du!“, wurde auch ich schließlich aufgefordert, dem Drang zu pressen endlich nachgeben zu dürfen. Und das tat ich. Ruckartig richtete ich meinen Oberkörper auf, schrie und begann zu pressen.
Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann erfüllte endlich ein leiser Schrei den Raum und die Schmerzen ließen nach.
So schnell es meine zitternden, schweren Beine zuließen ging ich hinunter in die Küche, zog mein Kleid aus und wusch mich so lange mit kochend heißem Wasser, bis meine Haut ganz rot und aufgedunsen war. Ich hörte die Haustür, als Edward zurück kam und schließlich lautes Gepolter auf der Treppe, als Mary, meine Tante und Edward meinen Onkel nach unten brachten. Dann ging wieder die Haustür und ich war mit Sidonie allein. „Miss?“, fragte sie vorsichtig, als ich gerade dabei war, mich mit einem Handtuch abzureiben. Da ich in meine Gedanken vertieft war, hatte ich gar nicht gemerkt, wie sie an mich heran getreten war und zuckte deshalb erschrocken zusammen. „Miss, darf ich?“ Ohne das ich wirklich wusste was sie eigentlich von mir wollte und ohne, das Sidonie meine Antwort abwartete, legte sie eine Hand an meine Stirn. Ich dachte schon, sie wollte fühlen ob ich ebenfalls Fieber hätte, doch ich täuschte mich. Leise begann sie etwas vor sich hin zu murmeln in einer Sprache, die ich nicht verstand, die aber angenehm beruhigend wirkte. Ich betrachtete die kleine Frau mit der dunklen Haut und den wilden schwarzen Locken verwundert, traute mich aber nicht etwas zu sagen. Es vergingen einige Sekunden, dann nahm sie ihre Hand wieder herunter und lächelte. „Das ist zum Schutz“, erklärte sie mir und wirkte ein wenig verlegen. „In Afrika machen das die Leute gegen Gefahr.“
Verblüfft riss ich die Augen auf. „Ähm… danke.“
Wieder lächelte sie mich an, dann griff sie nach dem Zinneimer in den sie das kochende Wasser gefüllt hatte und machte sich auf den Weg nach oben. Schwerfällig stieg ich in ein sauberes Kleid, das sie mir bereitgelegt hatte und ging durch den Flur in das Wohnzimmer. Auf eine sehr seltsame Art und Weise fühlte ich mich plötzlich wirklich sicher und mein Herz, das eben noch vor lauter Aufregung raste, schlug nun langsam und gleichmäßig. Sicheren Schrittes ging ich zu der Vitrine neben dem Sofa, öffnete die verglaste Tür und fand sofort wonach ich gesucht hatte. Ein kleines Kästchen aus dunklem Ebenholz. Vorsichtig nahm ich es heraus und setzte mich damit auf das Sofa. Als ich den kleinen silbernen Verschluss öffnete schnappte der Deckel auf und gab mir den Blick auf einen Rosenkranz aus dem gleichen dunklen Holz preis. Ich nahm die Kette in die Rechte. Das Kästchen legte ich neben mich auf das Polster. Die Perlen fühlten sich warm an, als ich sie durch meine Finger gleiten ließ, während ich leise anfing zu sprechen: „Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.“
Ich betete, während der Tag an mir vorüberzog. Ich betete und wartete, dass endlich meine Tante, Mary und Edward oder zumindest einer von ihnen heimkehren würde. Es dämmerte bereits, als ich die Haustür hörte. So schnell es mein schwerer Körper zuließ erhob ich mich und wollte in den Flur gehen, doch ein stechender Schmerz drückte mich umgehend zurück in die Polster. Ein lauter Schrei entfuhr mir, meine Hand verkrampfte sich um den Rosenkranz. Ich spürte eine warme Nässe meine Schenkel hinab laufen, als die Tür zum Salon aufflog und Mary, Edward und Sidonie herein stürmten. „Was ist passiert?“ Mit gehetztem Blick sah sich mein Cousin in dem Zimmer um, als erwartete er einem bewaffneten Einbrecher zu entdecken.
„Das…“ Ich japste nach Luft, als eine weitere Welle von Schmerzen durch meinen Körper rollte. „Das Baby“, stieß ich schließlich irgendwie hervor und kniff die Augen zusammen.
„Auch das noch“, nuschelte Mary.
„Ich… Oh verdammt“, fluchte Edward. „Der Wagen, er steht noch vor der Tür. Wir bringen dich ins Krankenhaus.“ Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich, dass er einen Schritt auf mich zu machen wollte, wahrscheinlich um mir auf zu helfen, aber Sidonie versperrte ihm den Weg.
„Sie können sie doch nicht in das Krankenhaus bringen wo all die kranken Leute sind“, blaffte sie ihn mit erstaunlich lauter Stimme an.
„Hast du eine bessere Idee?“ Edward schien ebenfalls völlig durcheinander über den plötzlich so bestimmenden Tonfall des Dienstmädchens.
„Sie bleibt hier. Niemand braucht einen Arzt um ein Kind zu bekommen und schon gar keine sterbenden Menschen um sich herum.“ Sidonie drehte sich zu mir um und griff nach meiner Hand, dann murmelte sie wieder etwas in ihrer Muttersprache. „Sie beide gehen in die Küche“, befahl sie sie Mary und Edward genau wie meine Tante es am Morgen noch getan hatte. „Waschen sie sich gründlich und heiß. Ich bringe Miss Anni nach oben. Wenn sie fertig sind kommen sie auch. Bringen sie heißes Wasser mit, Tücher und ein Messer.“ Vorsichtig zog sie meinen Arm hoch und legte ihn um ihre schmalen Schultern. Mit erstaunlicher Leichtigkeit zog sie mich auf die Füße und führte mich auf den Flur zur Treppe. „Alles wird gut. Ich hab schon viele Babys auf die Welt geholt.“ Wieder lächelte sie.
Ich wollte etwas erwidern, wollte ihr sagen, dass ich ihr glaubte und vertraute, doch mehr als ein leises Wimmern brachte ich nicht zur Stande. Die Treppe zu meinem Schlafzimmer war mir noch nie so hoch vorgekommen und die Stufen noch nie so zahlreich. Eine Wehe nach der anderen zog durch meinen Körper und ich hätte niemals vermutet, dass es noch schlimmer hätte werden können, doch es kam schlimmer. Ich verspürte eine kurze Erleichterung, als ich wir endlich mein Zimmer erreicht hatten und ich mich hinlegen konnte, doch dann wurden die Schmerzen richtig schlimm. Ich wollte pressen, das Kind aus meinem Körper schieben, doch Sidonie verbot es mir. „Noch nicht“, sagte sie bestimmend, nachdem sie meinen Rock hochgeschlagen und einen prüfenden Blick zwischen meine Beine geworfen hatte. Ich hätte wohl so etwas wie Scham empfinden sollen, doch in diesem Moment war mir alles egal. Ich wollte, dass der Schmerz endlich aufhörte. Mit all meiner Kraft drückte ich den Rosenkranz, den ich immer noch in meiner Hand hielt so fest, das ich das Holz splittern hören konnte.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange ich so da lag und schrie und versuchte zu atmen, während Sidonie immer wieder mit dem Kopf schüttelte und sagte „Noch nicht.“ Ich verstand einfach nicht wieso ich nicht pressen sollte. Dieses Kind wollte doch ganz offensichtlich heraus. Irgendwann klopfte es leise an der Tür und Mary trat ein. In den Händen hielt sie eine Schale dampfendes Wasser aus der, der Griff eines Messers ragte. Die weißen Handtücher hatte sie sich über den Arm gehangen. Sie stellte die Schüssel auf meinem Frisiertisch ab, die Tücher legte sie daneben. Dann wollte sie die Tür schließen, doch Sidonie war schneller.“Kommen sie rein!“, sagte sie barsch und verschwommen konnte ich erkennen, dass Edward auf dem Flur stand.
„Ich?“
„Stellen sie sich nicht so an!“ Sidonie machte zwei lange Schritte nach draußen und zerrte Edward dann am Arm in das Zimmer. „Halten sie ihre Hand!“ ordnete sie an und wies dann auf Mary. „Du hilfst mir hier.“
Was genau geschah kann ich nicht mehr sagen, aber Edward löste den Rosenkranz aus meinen schweißnassen Fingern und griff tatsächlich nach meiner Hand, während Mary und das Hausmädchen sich am Fußende des Bettes postierten. „Jetzt darfst du!“, wurde auch ich schließlich aufgefordert, dem Drang zu pressen endlich nachgeben zu dürfen. Und das tat ich. Ruckartig richtete ich meinen Oberkörper auf, schrie und begann zu pressen.
Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Dann erfüllte endlich ein leiser Schrei den Raum und die Schmerzen ließen nach.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 7 Part 1
*Rückblick*
Völlig kraftlos fiel ich zurück in Kissen. Irgendjemand, vermutlich Edward strich mir eine Haarsträhne aus der schweißnassen Stirn. Mein Herz schlug mit dem Tempo einer Eisenbahn, die Lunge brannte mir vom schreien, als hätte ich flüssiges Feuer getrunken und jeder restliche Zentimeter meines Körpers fühlte sich zugleich schmerzhaft wie auch seltsam taub an. Doch all das war mir egal. Das bisschen Kraft, dass ich noch besaß benötigte ich, um dem leisen schreien zu lauschen, während eine Welle von Gefühlen über mir zusammen brach.
„Ein Junge.“ Marys leise Stimme drang wie durch eine dicke Nebelwand an mein Ohr und als ich es endlich schaffte, meine Augen zu öffnen, stand meine Schwägerin direkt neben mir. Auch sie sah ein wenig abgekämpft aus. Dunkle Locken hatten sich aus ihrer wohlgesteckten Frisur gelöst und standen wild um ihr Gesicht herum in alle Richtungen ab. Eine Träne zeichnete eine feuchte Spur auf ihrer linken Wange, als sie das blutverschmierte Bündel in ihren Armen ansah.
Ein Junge, Mein Sohn. Thomas´ Sohn. Und es spielte nicht die geringste Rolle wie alt er werden würde. Thomas war nicht Odysseus und trieb sich in fernen Welten rum, da er den Göttern nicht gehuldigt hatte. Thomas würde nicht zurückkehren. Nie zuvor war mir das schmerzhafter bewusst gewesen, als in dem Moment, als ich meine Arme ausstreckte, um zum allerersten Mal mein Kind zu berühren.
Das Kind, das ich neun lange Monate unter meinem Herzen getragen hatte. Das Kind, das Thomas zu meinem Ehemann gemacht hatte. Das Kind, das seinen Vater niemals kennenlernen würde.
Behutsam legte Mary mir das Kind in die Arme. Automatisch begann ich ihn zu wiegen, während ich ihn zärtlich betrachtete. Er war perfekt. Dunkler Flaum bedeckte seinen kleinen Kopf und seine großen, blauen Augen schienen bereits jetzt vor Neugierde zu funkeln. „Hallo“, sagte ich leise und strich ihm über die geröteten Wangen. Wie durch ein Wunder schienen in diesem Moment alle Trauer und all der Stress der letzten Wochen von mir abzufallen. Die Welt um uns herum blieb einfach stehen und gab mir das Gefühl federleicht zu sein. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn dieser kleine Moment eine Ewigkeit hätte andauern können. Nur mein Sohn und ich. Niemand sonst. Keine Sorgen, keine Verantwortung und vor allen Dingen keine Trauer. Doch wie so oft im Leben, sind die Dinge die wir uns am meisten wünschen unerfüllbar.
„Weißt du schon wie er heißen soll?“ Edward hatte sich neben mich auf den Rand des Bettes gesetzt. Er musterte meinen Sohn, als wäre er eines der sieben Weltwunder, Eine Mischung aus ehrlicher Faszination und tiefem Schock stand ihm dabei ins Gesicht geschrieben. Und wer könnte es ihm nicht verdenken? Mein Cousin hatte sicher nicht damit gerechnet, jemals in seinem Leben hautnah einer Geburt beizuwohnen. Und schon gar nicht im zarten Alter von 16 Jahren.
Es gab nur einen Namen der mir einfiel und den ich meinem Sohn geben wollte. „Thomas.“ Kaum hatte dieser Name meine Lippen verlassen, da schluchzte Mary auch schon auf. Doch ich konnte in diesem Moment einfach keine Rücksicht auf ihren Schmerz und ihre Trauer nehmen. Mein Mann würde durch seinen Sohn weiterleben. Das war das mindeste, was ich Thomas Sommer schuldig war.
„Sie haben das wirklich gut gemacht, Miss Anni“, lobte mich Sidonie, die bis dahin am Ende des Bettes beschäftig war und der ich keinerlei Beachtung geschenkt hatte. Jetzt aber stand sie ebenfalls an der Seite meines Bettes, die Wasserschüssel in ihren Blutverschmierten Händen. „Ich bringe das hier eben raus und vergrabe es im Garten.“ Mit dem Kinn deutete sie auf den Inhalt der Schüssel, den ich gar nicht näher sehen wollte. „Ich komme mit Tee und sauberem Wasser wieder. Miss Mary, können sie das Bett neu beziehen und Miss Anni in ein sauberes Nachthemd helfen?“ Der Ton des Hausmädchens was nun wieder bittend und unterwürfig und bei weitem nicht mehr so bestimmend wie noch vor ein paar Stunden. „Und Mister Edward könnte das Bettchen aus dem Schuppen holen und aufstellen.“
„Was für ein Bettchen?“ Überrascht riss ich mich von dem hypnotisierenden Anblick meines Sohnes los und sah zu den dreien auf.
„Vater hat es vor einigen Wochen gekauft. Er wollte dich damit überraschen.“ Edward schnitt eine seltsame Grimasse, dann drehte er sich um und verschwand durch die Zimmertür. Erst jetzt fiel mir wieder ein, das mein Onkel erst vor wenigen Stunden schwer krank ins Hospital gebracht worden und meine Tante immer noch bei ihm war. Möglichst unauffällig schielte ich zu der schmalen Standuhr in der Ecke. Es war bereits nach Mitternacht. Ob sich der Zustand meines Onkels verschlechtert hatte? Ich schickte ein kurzes Gebet zum Himmel, dass es ihm bald besser gehen würde.
Auch Sidonie verließ nun den Raum, dicht gefolgt von Mary, die auf in dem großen Schrank auf dem Flur nach frischer Bettwäsche suchte. Alles was danach geschah ließ ich einfach über mich ergehen und versuchte, meinen Sohn so selten wie möglich aus den Augen zu lassen oder gar an Mary abzugeben. Diese zog einen Stuhl an das Bett und half mir, mich umsetzten, dann we4chselte sie die Lacken und Decken in einem Tempo, das ihr so schnell keiner nachmachen würde. Man hätte fast schon behaupten können, es wäre ein wenig schade, dass meine Schwägerin aus gut bürgerlichem Hause kam, denn sie hätte ein eins a Hausmädchen abgegeben. Ich übergab ihr Thomas nur ungern, aber ich musste es einfach tun, um mir mein Kleid auszuziehen und in mein Nachthemd zu schlüpfen, was gar nicht so einfach war, da ich mich kaum auf den Beinen halten konnte.
Und so war ich froh, als ich nur kurze Zeit später wieder in meinem sauberen Bett lag und Thomas wieder selbst halten durfte. Zumindest so lange, bis Sidonie kam und ihn mir wieder entriss. Sorgsam wusch sie die Spuren der Geburt von seinem kleinen faltigen Körper und wickelte ihn anschließend in Windeln und Decken. „Ich kann irgendwie noch gar nicht fassen, dass ich jetzt Tante bin“, murmelte Mary leise vor sich hin, als sie Thomas wieder zu mir trug. Ich konnte ihre Verwunderung durchaus nachvollziehen. Aber wenn es ihr schon schwer fiel, die letzten Stunden zu verarbeiten und zu verstehen, wie sollte es mir dann erst gehen? Ich war plötzlich eine Mutter. Und obwohl ich mir natürlich über mehrere Monate hinweg im Klaren darüber war, das ich es bald sein würde, so fühlte ich mich jetzt doch völlig unvorbereitet. Sehnlichst wünschte ich mir ein wenig Zeit um den kleinen Mann, der nun aus kräftigen Lungen schrie kennenzulernen.
„Ich glaube, der kleine Mann hat Hunger“, machte mich Sidonie auf den Grund des Geschreis aufmerksam.
„Oh.“ Darüber hatte ich in all dem Durcheinander noch gar nicht nachgedacht. Mit einer Hand öffnete ich die Schnürung an meinem Nachthemd, wobei ein heftiger Zweifel in mir aufstieg, ob ich der Mutterrolle überhaupt gerecht werden würde. Bisher hatte ich daran nicht einen einzigen Gedanken verschwendet, aber wenn mir schon nicht klar wurde, dass mein Kind vor Hunger schrie, wie sollte ich erst mit all den anderen Dingen klar kommen?
„Wir lassen euch beide jetzt mal allein.“ Sidonie hatte Mary am Arm gefasst und zog sie hinter sich her aus dem Zimmer. Die Tür fiel ins Schloss und ich hörte meine Schwägerin kurz draußen mit Edward sprechen, dann kehrte Ruhe ein. Etwas angespannt konzentrierte ich auf mich auf meinen Sohn, den ich ungeschickt an meine Brust drückte, bis er gefunden hatte wonach er suchte. Zufrieden saugte er und mir wurden die Augen vor Müdigkeit immer schwerer.
Wie von der Tarantel gestochen fuhr ich aus einem wirren Traum auf. Ich war eingeschlafen. Einfach so, mit meinem Sohn in den Armen. Doch meine Arme waren nun leer. Was war geschehen? Ich bekam Panik und befürchtete ich hätte ihn gar fallen gelassen oder schlimmeres, als mich eine kalte Hand am Arm faste. „Er schläft.“ Vor lauter Schreck schwer atmend sah ich zu dem Gesicht meiner Tante auf. Der Tag war bereits angebrochen, doch jemand hatte die Vorhänge zugezogen, so dass nur wenig Licht in den Raum fiel. Mit der freien Hand deutete sie auf die Wiege am Fußende meines Bettes und setzte sich schließlich neben mich. Dunkle Schatten lagen unter ihren grünen Katzenaugen und ihr Blick wirkte seltsam leer, als sie mir beruhigend den Arm tätschelte. „Sidonie sagt, dass du das sehr gut hinbekommen hast. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, aber ich bin sehr stolz auf dich.“
„Danke.“ Meine Stimme war noch belegt vom Schlaf und ich griff nach der Teetasse, die jemand mit Wasser aufgefüllt hatte und trank. Mir schmerzte der Unterleib genau wie mein Bauch und meine Beine, aber der Schlaf hatte mir gut getan. Und Schlaf hatte auch meine Tante offensichtlich bitter nötig. Ich wollte mich nach meinem Onkel erkundigen, doch ich fand nicht die richtigen Worte. In meinem Kopf herrschte einfach zu viel Durcheinander. Doch sie kam mir zuvor.
Langsam wandte sie ihren Blick von der Wiege ab und sah auf mich herunter. „Fehlt dir Thomas sehr?“
Verwundert legte ich den Kopf schief. Natürlich hatte ich die Frage verstanden, aber ich wusste nicht, warum sie sie ausgerechnet jetzt stellte. Zumindest verstand ich sie solange nicht, bis ich ihr direkt ins Gesicht blickte. Meine Tante hatte die sonst so vollen, rosigen Lippen hart aufeinander gepresst, so dass sie kaum mehr als schmale Linienüber ihrem bebenden Kinn waren. Ihre Nase glänzte auffällig und als schließlich die ersten Tränen begannen aus ihren Augenwinkeln zu rinnen, da fiel auch in meinem müden Hirn der Groschen. Unfähig auch nur ein einziges Wort zu sprechen schloss ich meine Tante in die Arme und versuchte ihr Trost zu spenden, wo ich doch selbst untröstlich war.
Völlig kraftlos fiel ich zurück in Kissen. Irgendjemand, vermutlich Edward strich mir eine Haarsträhne aus der schweißnassen Stirn. Mein Herz schlug mit dem Tempo einer Eisenbahn, die Lunge brannte mir vom schreien, als hätte ich flüssiges Feuer getrunken und jeder restliche Zentimeter meines Körpers fühlte sich zugleich schmerzhaft wie auch seltsam taub an. Doch all das war mir egal. Das bisschen Kraft, dass ich noch besaß benötigte ich, um dem leisen schreien zu lauschen, während eine Welle von Gefühlen über mir zusammen brach.
„Ein Junge.“ Marys leise Stimme drang wie durch eine dicke Nebelwand an mein Ohr und als ich es endlich schaffte, meine Augen zu öffnen, stand meine Schwägerin direkt neben mir. Auch sie sah ein wenig abgekämpft aus. Dunkle Locken hatten sich aus ihrer wohlgesteckten Frisur gelöst und standen wild um ihr Gesicht herum in alle Richtungen ab. Eine Träne zeichnete eine feuchte Spur auf ihrer linken Wange, als sie das blutverschmierte Bündel in ihren Armen ansah.
Ein Junge, Mein Sohn. Thomas´ Sohn. Und es spielte nicht die geringste Rolle wie alt er werden würde. Thomas war nicht Odysseus und trieb sich in fernen Welten rum, da er den Göttern nicht gehuldigt hatte. Thomas würde nicht zurückkehren. Nie zuvor war mir das schmerzhafter bewusst gewesen, als in dem Moment, als ich meine Arme ausstreckte, um zum allerersten Mal mein Kind zu berühren.
Das Kind, das ich neun lange Monate unter meinem Herzen getragen hatte. Das Kind, das Thomas zu meinem Ehemann gemacht hatte. Das Kind, das seinen Vater niemals kennenlernen würde.
Behutsam legte Mary mir das Kind in die Arme. Automatisch begann ich ihn zu wiegen, während ich ihn zärtlich betrachtete. Er war perfekt. Dunkler Flaum bedeckte seinen kleinen Kopf und seine großen, blauen Augen schienen bereits jetzt vor Neugierde zu funkeln. „Hallo“, sagte ich leise und strich ihm über die geröteten Wangen. Wie durch ein Wunder schienen in diesem Moment alle Trauer und all der Stress der letzten Wochen von mir abzufallen. Die Welt um uns herum blieb einfach stehen und gab mir das Gefühl federleicht zu sein. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn dieser kleine Moment eine Ewigkeit hätte andauern können. Nur mein Sohn und ich. Niemand sonst. Keine Sorgen, keine Verantwortung und vor allen Dingen keine Trauer. Doch wie so oft im Leben, sind die Dinge die wir uns am meisten wünschen unerfüllbar.
„Weißt du schon wie er heißen soll?“ Edward hatte sich neben mich auf den Rand des Bettes gesetzt. Er musterte meinen Sohn, als wäre er eines der sieben Weltwunder, Eine Mischung aus ehrlicher Faszination und tiefem Schock stand ihm dabei ins Gesicht geschrieben. Und wer könnte es ihm nicht verdenken? Mein Cousin hatte sicher nicht damit gerechnet, jemals in seinem Leben hautnah einer Geburt beizuwohnen. Und schon gar nicht im zarten Alter von 16 Jahren.
Es gab nur einen Namen der mir einfiel und den ich meinem Sohn geben wollte. „Thomas.“ Kaum hatte dieser Name meine Lippen verlassen, da schluchzte Mary auch schon auf. Doch ich konnte in diesem Moment einfach keine Rücksicht auf ihren Schmerz und ihre Trauer nehmen. Mein Mann würde durch seinen Sohn weiterleben. Das war das mindeste, was ich Thomas Sommer schuldig war.
„Sie haben das wirklich gut gemacht, Miss Anni“, lobte mich Sidonie, die bis dahin am Ende des Bettes beschäftig war und der ich keinerlei Beachtung geschenkt hatte. Jetzt aber stand sie ebenfalls an der Seite meines Bettes, die Wasserschüssel in ihren Blutverschmierten Händen. „Ich bringe das hier eben raus und vergrabe es im Garten.“ Mit dem Kinn deutete sie auf den Inhalt der Schüssel, den ich gar nicht näher sehen wollte. „Ich komme mit Tee und sauberem Wasser wieder. Miss Mary, können sie das Bett neu beziehen und Miss Anni in ein sauberes Nachthemd helfen?“ Der Ton des Hausmädchens was nun wieder bittend und unterwürfig und bei weitem nicht mehr so bestimmend wie noch vor ein paar Stunden. „Und Mister Edward könnte das Bettchen aus dem Schuppen holen und aufstellen.“
„Was für ein Bettchen?“ Überrascht riss ich mich von dem hypnotisierenden Anblick meines Sohnes los und sah zu den dreien auf.
„Vater hat es vor einigen Wochen gekauft. Er wollte dich damit überraschen.“ Edward schnitt eine seltsame Grimasse, dann drehte er sich um und verschwand durch die Zimmertür. Erst jetzt fiel mir wieder ein, das mein Onkel erst vor wenigen Stunden schwer krank ins Hospital gebracht worden und meine Tante immer noch bei ihm war. Möglichst unauffällig schielte ich zu der schmalen Standuhr in der Ecke. Es war bereits nach Mitternacht. Ob sich der Zustand meines Onkels verschlechtert hatte? Ich schickte ein kurzes Gebet zum Himmel, dass es ihm bald besser gehen würde.
Auch Sidonie verließ nun den Raum, dicht gefolgt von Mary, die auf in dem großen Schrank auf dem Flur nach frischer Bettwäsche suchte. Alles was danach geschah ließ ich einfach über mich ergehen und versuchte, meinen Sohn so selten wie möglich aus den Augen zu lassen oder gar an Mary abzugeben. Diese zog einen Stuhl an das Bett und half mir, mich umsetzten, dann we4chselte sie die Lacken und Decken in einem Tempo, das ihr so schnell keiner nachmachen würde. Man hätte fast schon behaupten können, es wäre ein wenig schade, dass meine Schwägerin aus gut bürgerlichem Hause kam, denn sie hätte ein eins a Hausmädchen abgegeben. Ich übergab ihr Thomas nur ungern, aber ich musste es einfach tun, um mir mein Kleid auszuziehen und in mein Nachthemd zu schlüpfen, was gar nicht so einfach war, da ich mich kaum auf den Beinen halten konnte.
Und so war ich froh, als ich nur kurze Zeit später wieder in meinem sauberen Bett lag und Thomas wieder selbst halten durfte. Zumindest so lange, bis Sidonie kam und ihn mir wieder entriss. Sorgsam wusch sie die Spuren der Geburt von seinem kleinen faltigen Körper und wickelte ihn anschließend in Windeln und Decken. „Ich kann irgendwie noch gar nicht fassen, dass ich jetzt Tante bin“, murmelte Mary leise vor sich hin, als sie Thomas wieder zu mir trug. Ich konnte ihre Verwunderung durchaus nachvollziehen. Aber wenn es ihr schon schwer fiel, die letzten Stunden zu verarbeiten und zu verstehen, wie sollte es mir dann erst gehen? Ich war plötzlich eine Mutter. Und obwohl ich mir natürlich über mehrere Monate hinweg im Klaren darüber war, das ich es bald sein würde, so fühlte ich mich jetzt doch völlig unvorbereitet. Sehnlichst wünschte ich mir ein wenig Zeit um den kleinen Mann, der nun aus kräftigen Lungen schrie kennenzulernen.
„Ich glaube, der kleine Mann hat Hunger“, machte mich Sidonie auf den Grund des Geschreis aufmerksam.
„Oh.“ Darüber hatte ich in all dem Durcheinander noch gar nicht nachgedacht. Mit einer Hand öffnete ich die Schnürung an meinem Nachthemd, wobei ein heftiger Zweifel in mir aufstieg, ob ich der Mutterrolle überhaupt gerecht werden würde. Bisher hatte ich daran nicht einen einzigen Gedanken verschwendet, aber wenn mir schon nicht klar wurde, dass mein Kind vor Hunger schrie, wie sollte ich erst mit all den anderen Dingen klar kommen?
„Wir lassen euch beide jetzt mal allein.“ Sidonie hatte Mary am Arm gefasst und zog sie hinter sich her aus dem Zimmer. Die Tür fiel ins Schloss und ich hörte meine Schwägerin kurz draußen mit Edward sprechen, dann kehrte Ruhe ein. Etwas angespannt konzentrierte ich auf mich auf meinen Sohn, den ich ungeschickt an meine Brust drückte, bis er gefunden hatte wonach er suchte. Zufrieden saugte er und mir wurden die Augen vor Müdigkeit immer schwerer.
Wie von der Tarantel gestochen fuhr ich aus einem wirren Traum auf. Ich war eingeschlafen. Einfach so, mit meinem Sohn in den Armen. Doch meine Arme waren nun leer. Was war geschehen? Ich bekam Panik und befürchtete ich hätte ihn gar fallen gelassen oder schlimmeres, als mich eine kalte Hand am Arm faste. „Er schläft.“ Vor lauter Schreck schwer atmend sah ich zu dem Gesicht meiner Tante auf. Der Tag war bereits angebrochen, doch jemand hatte die Vorhänge zugezogen, so dass nur wenig Licht in den Raum fiel. Mit der freien Hand deutete sie auf die Wiege am Fußende meines Bettes und setzte sich schließlich neben mich. Dunkle Schatten lagen unter ihren grünen Katzenaugen und ihr Blick wirkte seltsam leer, als sie mir beruhigend den Arm tätschelte. „Sidonie sagt, dass du das sehr gut hinbekommen hast. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, aber ich bin sehr stolz auf dich.“
„Danke.“ Meine Stimme war noch belegt vom Schlaf und ich griff nach der Teetasse, die jemand mit Wasser aufgefüllt hatte und trank. Mir schmerzte der Unterleib genau wie mein Bauch und meine Beine, aber der Schlaf hatte mir gut getan. Und Schlaf hatte auch meine Tante offensichtlich bitter nötig. Ich wollte mich nach meinem Onkel erkundigen, doch ich fand nicht die richtigen Worte. In meinem Kopf herrschte einfach zu viel Durcheinander. Doch sie kam mir zuvor.
Langsam wandte sie ihren Blick von der Wiege ab und sah auf mich herunter. „Fehlt dir Thomas sehr?“
Verwundert legte ich den Kopf schief. Natürlich hatte ich die Frage verstanden, aber ich wusste nicht, warum sie sie ausgerechnet jetzt stellte. Zumindest verstand ich sie solange nicht, bis ich ihr direkt ins Gesicht blickte. Meine Tante hatte die sonst so vollen, rosigen Lippen hart aufeinander gepresst, so dass sie kaum mehr als schmale Linienüber ihrem bebenden Kinn waren. Ihre Nase glänzte auffällig und als schließlich die ersten Tränen begannen aus ihren Augenwinkeln zu rinnen, da fiel auch in meinem müden Hirn der Groschen. Unfähig auch nur ein einziges Wort zu sprechen schloss ich meine Tante in die Arme und versuchte ihr Trost zu spenden, wo ich doch selbst untröstlich war.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 7 Part 2
Da die Menschen in der Stadt in spanische Grippe sehr fürchteten, wurde mein Onkel noch am selben Tag zu Grabe getragen, ohne das ich die Chance hatte mich noch einmal zu verabschieden. Natürlich verstand ich, dass es so sein musste. Meine Tante hatte nur mit Müh und not verhindern können, dass sie ihn direkt nach seinem Ableben in eines der Seuchengräber hinter dem Hospital warfen. Eine Woche später bekam ich dann wenigstens die Chance, meinem Onkel auf meine ganz eigene Art und Weise, meine Anerkennung auszudrücken. Ich gab meinem Sohn die Namen der Männer, die mich geliebt und geschützt hatten und die nur starben, damit Gott mich bestrafen konnte. Thomas Edward Sommer wurde wahrlich in eine finstere Zeit hineingeboren, doch sein charmantes Lächeln schaffte es hin und wieder doch, einen jeden von uns von unseren Ängsten und Sorgen abzulenken.
Viele Menschen starben in diesem Frühling an der spanischen Grippe. In Chicago genauso, wie in der ganzen Welt. Es sei die Rache für all unsere Sünden, wurde in der Kirche gepredigt und irgendwie war es nur wenig tröstlich, das der Pfarrer dieses Mal nicht nur mich ansah, sondern seinen ausgestreckten Zeigefinger über die komplette Gemeinde wandern ließ. Doch die spanische Grippe verschwand mit dem Sommer. Es schien mir fast ein wenig unglaublich, dass ich noch vor einem Jahr ein unbeschwertes Mädchen war, das einzig und allein von den Schmetterlingen in ihrem Bauch lebte. Nun war ich Mutter, Witwe und ein wenig auch Halbwaise. Es war keine schöne Zeit für uns alle aber dennoch keimte in mir die Hoffnung auf, dass Gott mich nun zu genüge bestraft hätte. Ich sehnte mich danach, die Trümmer meines Lebens zu sortieren und mir aus dem was geblieben war eine neue Zukunft zu erschaffen. Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde und, dass es viel Zeit brauchen würde, aber ich wollte endlich wieder Freude empfinden können.
Ich hoffte vergebens, denn die spanische Grippe war nicht vorbei, sie hatte nur eine Pause gemacht. Anfang August erreichte uns ein Brief aus Oregon von Marys Tante und er brachte schlechte Nachrichten. An der Westküste war die spanische Grippe wieder ausgebrochen und hatte sich Mister Sommer als Opfer auserkoren. Und wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, so hatte sich der Zustand von Marys Mutter über den Tod ihres Gatten dramatisch verschlechtert. Meine Schwägerin wurde zu einem Schatten ihrer selbst, als auch das letzte bisschen Glanz aus ihren Augen verschwand. Und ich wollte nur noch schreien. Wollte all meine Wut herausschreiben über einen Gott der doch angeblich barmherzig war und doch nichts Besseres zu tun hatte, als solch grausame Spiele mit zu treiben. Es war einfach unfair. Ich hatte für meine Sünde wahrlich genug gebüßt und Mary hatte überhaupt nichts Schlimmes getan, dass es gerechtfertigt hätte ihr Bruder und Vater zu nehmen und noch dazu ihre Mutter in den Wahnsinn zu treiben. Ebenso war meine Tante eine aufrechte und tugendhafte Frau, die es nicht verdient hatte mit anzusehen, wie ihr Mann qualvoll dahin gerafft wurde. Ich wollte schreien, mit den Füßen aufstampfen und meine Füße ballen, doch am Ende blieb ich genauso erstarrt vor diesem grausamen Gott wie alle anderen auch.
Es dauerte nicht lange, bis die spanische Grippe sich ihren Weg von der Westküste zurück nach Chicago gesucht hatte. Unter der Führung meiner Tante versuchten wir alles menschenmögliche, um einen weiteren Todesfall in der Familie vorzubeugen. So verließen wir zum Beispiel nur noch das Haus, wenn es sich kaum vermeiden ließ und wuschen uns unablässig. Meine Sorge galt vor allem Tom. Er war schließlich noch ein Baby und würde der Krankheit nicht lange standhalten können, wenn sie sich ihn schnappte. Mein eigenes Leben war mir zu diesem Zeitpunkt bereits völlig egal. Ich wollte nur mein Kind schützen. Wenn nötig, mit meinem eigenen Leben. Ein Urinstinkt, der mich zu einer wilden Löwin machte.
Doch was nützt einen das Herz einer Löwin, wenn die eigene Tante plötzlich am Fuße der Treppe zusammenbricht, geschüttelt von heftigem Fieber? Es nützt einen nichts. Es macht dich nicht stärker. Es zeigt einem nur, wie hilflos und ausgeliefert man dem Leben gegenüber stand. All unsere Bemühungen waren Vergebens. Obwohl wir sie direkt ins Krankenhaus brachten, verschlechterte sich ihr Zustand sehr schnell. Ich machte mir wahnsinnige Sorgen um sie, doch ich durfte sie nicht besuchen. Edward, Mary und Sidonie verboten es mir mit einem Starrsinn, dem ich kaum die Stirn bieten konnte. Ich musste mich um Tom kümmern. Durfte nicht riskieren, mich ebenfalls anzustecken. Hatte ich zuvor kaum noch das Haus verlassen, so verließ ich nun kaum noch mein Zimmer. Ich fürchtete, mich würde ein ähnliches Schicksal ereilen, wie das meiner Schwiegermutter, denn die Grenze zum Wahnsinn war kaum noch einen Steinwurf von mir entfernt.
Ich fühlte mich wie eine Gefangene. Und nicht nur gefangen im eigenen Haus, sondern auch noch gefangen in der Ungewissheit. Mir fehlen teilweise ganze Stunden dieser grausamen Zeit, die ich lethargisch auf meinem Bett saß und verzweifelt versuchte zu lesen, obwohl das Buch nur dazu diente, mich an etwas festzuhalten. Nur um meine Notdurft zu verrichten oder zu den Mahlzeiten verließ ich mein Zimmer. Gemeinsam mit Mary und Edward war das Essen immer eine sehr stille Angelegenheit, denn wir alle fürchteten uns so sehr.
„Sie hat in den letzten zwei Tagen kaum noch gesprochen und wenn sie die Augen öffnet wirkt sie sehr verwirrt“, erzählte Edward leise von dem letzten Besuch bei seiner Mutter im Krankenhaus. Möglichst unauffällig versuchte ich ihn aus dem Augenwinkel zu mustern. Er sah nicht besser aus als Mary oder ich. Auch er war mager. Wir alle spielten beim Essen nur noch eine Scharade, die daraus bestand, die Nahrungsmittel über einen angemessenen Zeitraum über den Teller zu schieben. Neben dem offensichtlichen Gewichtsverlust war er außerdem unnatürlich blass und tiefrote Ringe zeichneten seine nun trüben Augen. „Ich werde gleich wieder zu ihr gehen. Ich… ich fürchte…“ Er brach ab und schluckte heftig.
Ich schob meinen Stuhl mit einem leisen Knarren zurück, um aufzustehen. Ich wollte ihn in die Arme schließen und ihm genau wie mir vorlügen, dass alles wieder gut werden würde. Doch noch bevor ich mich erhoben hatte ließ mir mein Cousin einen vernichtenden Blick zukommen. Er hatte mir verboten ihn zu berühren. Geräuschvoll stieß ich die Luft aus meinen, zum ersticken eng gewordenen Lungen und rückte den Stuhl wieder an den Tisch. „Du solltest dich vorher ein wenig hinlegen. Du siehst nicht gut aus.“
„Es ist nichts.“ Mit einer abwehrenden Geste ließ Edward seine fallen und stand auf. „Ich bin nur müde. Mutter braucht mich.“ Mit wenig Elan drehte er sich um verließ den Salon, um an das Bett seiner sterben Mutter zu eilen und ihr die Hand im Tod zu halten.
Hätte ich damals gewusst, dass ich ihn das letzte Mal sehen würde, ich hätte alle Regeln der Vernunft ignoriert. Ich hätte mich an seinen Hals geworfen und ihn angefleht, dass wenigstens er bei mir bleiben würde. Und wenn ich es doch nicht hätte verhindern können, so hätte ich ihm doch wenigstens noch gesagt, dass ich ihn liebte wie einen Bruder, auch über den Tod hinaus…
*Rückblick Ende*
Viele Menschen starben in diesem Frühling an der spanischen Grippe. In Chicago genauso, wie in der ganzen Welt. Es sei die Rache für all unsere Sünden, wurde in der Kirche gepredigt und irgendwie war es nur wenig tröstlich, das der Pfarrer dieses Mal nicht nur mich ansah, sondern seinen ausgestreckten Zeigefinger über die komplette Gemeinde wandern ließ. Doch die spanische Grippe verschwand mit dem Sommer. Es schien mir fast ein wenig unglaublich, dass ich noch vor einem Jahr ein unbeschwertes Mädchen war, das einzig und allein von den Schmetterlingen in ihrem Bauch lebte. Nun war ich Mutter, Witwe und ein wenig auch Halbwaise. Es war keine schöne Zeit für uns alle aber dennoch keimte in mir die Hoffnung auf, dass Gott mich nun zu genüge bestraft hätte. Ich sehnte mich danach, die Trümmer meines Lebens zu sortieren und mir aus dem was geblieben war eine neue Zukunft zu erschaffen. Ich wusste, dass es nicht einfach werden würde und, dass es viel Zeit brauchen würde, aber ich wollte endlich wieder Freude empfinden können.
Ich hoffte vergebens, denn die spanische Grippe war nicht vorbei, sie hatte nur eine Pause gemacht. Anfang August erreichte uns ein Brief aus Oregon von Marys Tante und er brachte schlechte Nachrichten. An der Westküste war die spanische Grippe wieder ausgebrochen und hatte sich Mister Sommer als Opfer auserkoren. Und wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, so hatte sich der Zustand von Marys Mutter über den Tod ihres Gatten dramatisch verschlechtert. Meine Schwägerin wurde zu einem Schatten ihrer selbst, als auch das letzte bisschen Glanz aus ihren Augen verschwand. Und ich wollte nur noch schreien. Wollte all meine Wut herausschreiben über einen Gott der doch angeblich barmherzig war und doch nichts Besseres zu tun hatte, als solch grausame Spiele mit zu treiben. Es war einfach unfair. Ich hatte für meine Sünde wahrlich genug gebüßt und Mary hatte überhaupt nichts Schlimmes getan, dass es gerechtfertigt hätte ihr Bruder und Vater zu nehmen und noch dazu ihre Mutter in den Wahnsinn zu treiben. Ebenso war meine Tante eine aufrechte und tugendhafte Frau, die es nicht verdient hatte mit anzusehen, wie ihr Mann qualvoll dahin gerafft wurde. Ich wollte schreien, mit den Füßen aufstampfen und meine Füße ballen, doch am Ende blieb ich genauso erstarrt vor diesem grausamen Gott wie alle anderen auch.
Es dauerte nicht lange, bis die spanische Grippe sich ihren Weg von der Westküste zurück nach Chicago gesucht hatte. Unter der Führung meiner Tante versuchten wir alles menschenmögliche, um einen weiteren Todesfall in der Familie vorzubeugen. So verließen wir zum Beispiel nur noch das Haus, wenn es sich kaum vermeiden ließ und wuschen uns unablässig. Meine Sorge galt vor allem Tom. Er war schließlich noch ein Baby und würde der Krankheit nicht lange standhalten können, wenn sie sich ihn schnappte. Mein eigenes Leben war mir zu diesem Zeitpunkt bereits völlig egal. Ich wollte nur mein Kind schützen. Wenn nötig, mit meinem eigenen Leben. Ein Urinstinkt, der mich zu einer wilden Löwin machte.
Doch was nützt einen das Herz einer Löwin, wenn die eigene Tante plötzlich am Fuße der Treppe zusammenbricht, geschüttelt von heftigem Fieber? Es nützt einen nichts. Es macht dich nicht stärker. Es zeigt einem nur, wie hilflos und ausgeliefert man dem Leben gegenüber stand. All unsere Bemühungen waren Vergebens. Obwohl wir sie direkt ins Krankenhaus brachten, verschlechterte sich ihr Zustand sehr schnell. Ich machte mir wahnsinnige Sorgen um sie, doch ich durfte sie nicht besuchen. Edward, Mary und Sidonie verboten es mir mit einem Starrsinn, dem ich kaum die Stirn bieten konnte. Ich musste mich um Tom kümmern. Durfte nicht riskieren, mich ebenfalls anzustecken. Hatte ich zuvor kaum noch das Haus verlassen, so verließ ich nun kaum noch mein Zimmer. Ich fürchtete, mich würde ein ähnliches Schicksal ereilen, wie das meiner Schwiegermutter, denn die Grenze zum Wahnsinn war kaum noch einen Steinwurf von mir entfernt.
Ich fühlte mich wie eine Gefangene. Und nicht nur gefangen im eigenen Haus, sondern auch noch gefangen in der Ungewissheit. Mir fehlen teilweise ganze Stunden dieser grausamen Zeit, die ich lethargisch auf meinem Bett saß und verzweifelt versuchte zu lesen, obwohl das Buch nur dazu diente, mich an etwas festzuhalten. Nur um meine Notdurft zu verrichten oder zu den Mahlzeiten verließ ich mein Zimmer. Gemeinsam mit Mary und Edward war das Essen immer eine sehr stille Angelegenheit, denn wir alle fürchteten uns so sehr.
„Sie hat in den letzten zwei Tagen kaum noch gesprochen und wenn sie die Augen öffnet wirkt sie sehr verwirrt“, erzählte Edward leise von dem letzten Besuch bei seiner Mutter im Krankenhaus. Möglichst unauffällig versuchte ich ihn aus dem Augenwinkel zu mustern. Er sah nicht besser aus als Mary oder ich. Auch er war mager. Wir alle spielten beim Essen nur noch eine Scharade, die daraus bestand, die Nahrungsmittel über einen angemessenen Zeitraum über den Teller zu schieben. Neben dem offensichtlichen Gewichtsverlust war er außerdem unnatürlich blass und tiefrote Ringe zeichneten seine nun trüben Augen. „Ich werde gleich wieder zu ihr gehen. Ich… ich fürchte…“ Er brach ab und schluckte heftig.
Ich schob meinen Stuhl mit einem leisen Knarren zurück, um aufzustehen. Ich wollte ihn in die Arme schließen und ihm genau wie mir vorlügen, dass alles wieder gut werden würde. Doch noch bevor ich mich erhoben hatte ließ mir mein Cousin einen vernichtenden Blick zukommen. Er hatte mir verboten ihn zu berühren. Geräuschvoll stieß ich die Luft aus meinen, zum ersticken eng gewordenen Lungen und rückte den Stuhl wieder an den Tisch. „Du solltest dich vorher ein wenig hinlegen. Du siehst nicht gut aus.“
„Es ist nichts.“ Mit einer abwehrenden Geste ließ Edward seine fallen und stand auf. „Ich bin nur müde. Mutter braucht mich.“ Mit wenig Elan drehte er sich um verließ den Salon, um an das Bett seiner sterben Mutter zu eilen und ihr die Hand im Tod zu halten.
Hätte ich damals gewusst, dass ich ihn das letzte Mal sehen würde, ich hätte alle Regeln der Vernunft ignoriert. Ich hätte mich an seinen Hals geworfen und ihn angefleht, dass wenigstens er bei mir bleiben würde. Und wenn ich es doch nicht hätte verhindern können, so hätte ich ihm doch wenigstens noch gesagt, dass ich ihn liebte wie einen Bruder, auch über den Tod hinaus…
*Rückblick Ende*
Gast- Gast
 Kapitel 8
Kapitel 8
Kapitel 8
*Gegenwart*
*Gegenwart*
„Was soll das heißen du gehst weg, Jo?“ Völlig irritier versperrte mir Holly die Tür zum Arbeitszimmer, aus dem ich gerade ein paar Bücher holen wollte um sie in meinen Koffer zu packen. Ich konnte es mir nicht verkneifen, genervt mit den Augen zu rollen, schließlich rannte sie mittlerweile seit einer geschlagenen halben Stunde hinter mir her und versuchte auf mich einzureden. Meine ganze Beherrschung aufbringend, da ich sie nicht verletzten wollte, griff ich nach ihrem Arm und drehte ihn leicht zur Seite, um mir Eintritt zu verschaffen. Die Bücher die ich hatte mitnehmen wollen, lagen bereits ordentlich gestapelt auf dem Schreibtisch von dem Computer. Ich ergriff den Stapel und ging zurück ins Schlafzimmer. Holly dicht auf meinen Fersen.
„Jo, du kannst doch jetzt nicht alles hinschmeißen und gehen. Das geht doch nicht. Ich meine, du kannst doch wenigstens erst mal das Studium zu Ende bringen.“ Ich seufzte verächtlich in meine Tasche. Ein Abschluss mehr oder weniger, was machte das schon aus? Ich verkniff mir den bissigen Kommentar, der mir auf der Zunge lag. Stattdessen prüfte ich noch einmal den Inhalt meines Koffers, klappte dann den Deckel zu und verschloss ihn. „Und was ist überhaupt mit dem Haus und den ganzen Sachen? Du kannst doch nicht einfach die Tür hinter dir zuziehen und das war´s.“
Da hatte sie Recht. Das hatte ich auch nicht vor, obwohl ich es gekonnt hätte. Das Haus war Collins und somit auch mein Eigentum gewesen und kostete mich von daher nicht einen lächerlichen Penny. Ich war mir noch nicht schlüssig, was genau ich mit dem Grundstück und den damit verbundenen Erinnerungen vorhatte. Im Moment wollte ich allerdings nur weg. „Ich kümmere mich um das Haus, sobald ich weiß wie es weitergeht und wo ich bleibe.“ Mit einem sanften Ruck zog ich den Koffer vom Bett, wobei ich so tat, als müsste ich mich wahnsinnig anstrengen. Mit einem leisen Knall landete das Reiseutensil auf dem Fußboden, wo ich den Zuggriff herauszog, um meine perfekte Scharade aufrecht zu erhalten. Ich hätte mir das Teil natürlich auch ebenso gut unter den Arm klemmen und mit Leichtigkeit in den Kofferraum des wartenden Taxis werfen können.
„Und wieso eigentlich Amerika? Kennst du irgendwen in Amerika? Hast du da Freunde oder Verwandte?“ Mich überkam das leichte Gefühl, dass Holly einem Nervenzusammenbruch nicht mehr all´ zu fern war, so schnell sprudelten die Fragen über ihre ungewöhnlich blassen Lippen. Blieb nur zu hoffen, dass sie sich nicht noch auf den Boden warf und mich anflehte nicht zu gehen oder irgendein anderes Drama in diese Richtung veranstaltete.
Ich konnte natürlich verstehen, dass sie sich Sorgen machte. Sie war schließlich der festen Auffassung, dass meine Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen, als ich noch ein kleines Mädchen war und das ich seit dem bei meinem Großvater gelebt hatte, da ich keine anderen Verwandten hatte. Wie sollte ich ihr denn erklären, dass ich mich in die Wahnvorstellung verrannt hatte, meinen Cousin, der vor 87 Jahre verstorben war, auf einem Foto im Internet gesehen zu haben. „Ich äh… ich habe Bekannte in… äh… Seattle“, log ich ziemlich plump. Aber selbst wenn ich der Wahrheit entsprechend irgendwelche Verwandten in den Vereinigten Staaten hätte aufweisen können, hätte ich Holly damit auch nicht beruhigen können. Von daher spielte es keine Rolle was ich zu ihr sagte.
Ich zog den Koffer hinter mir her auf den Flur, wo ich die Verkleidung des Sicherungskastens abnahm und die Stromzuvor des Hauses abstellte. Ein letztes Mal sah ich zurück. Zurück auf ein Dasein, das mir fast wie ein Leben vorgekommen war. Zurück auf eine Existenz, die ich so nie wieder erleben würde. Ich atmete tief ein und aus, dann drehte ich mir zur Haustür, um alles was gewesen war hinter mir zu lassen. Ich hatte die Tür schon fast erreicht. Ein Schritt noch, den Arm ausstrecken, die Klinke runter drücken, die Tür öffnen, hinaus treten und die Tür wieder hinter mir zuziehen. Dann hätte ich es geschafft. „Jo!“ Hollys Hand griff mich an der Schulter und ich blieb stehen um mich ihr und damit auch wieder der Vergangenheit zuzuwenden. „Deine Jacke!“ Besorgt sah sie mich an, den schwarzen Mantel in ihren verkrampften Fingern. „Du bist ja völlig durcheinander. DU solltest wirklich hier bleiben.“
„Es geht mir gut.“ Ich rang ein mühsames Lächeln auf mein Gesicht und löste die Finger meiner Freundin von dem so unnötigen, wärmenden Kleidungsstück, um hinein zu schlüpfen. Ich nahm die Handschuhe, den Schal und die Mütze, die Holly mir reichte ebenfalls entgegen und kleidete mich wintergerecht ein. „Mach dir bitte keine Sorgen um mich. Ich komm schon klar. Und nun komm.“ Geschützt durch die Handschuhe konnte ich ohne Probleme nach ihrer Hand greifen, um sie hinter mir her aus dem Haus zu ziehen. Ich wollte nun endlich weg von hier.
Der Taxifahrer hatte mit den Rücken an seinem Wagen gelehnt und zog nun eine Grimasse, die gleichzeitig seine Genervtheit zum Ausdruck brachte, da er so lange hatte warten müssen, als auch Erleichterung wiederspiegelte. „Na endlich“, teilte er ganz unverhohlen mit und riss mir den Koffer aus der Hand. „Der Taxameter läuft.“
„Das freut mich für sie. Das nennt man dann wohl leicht verdientes Geld.“ Ich konnte mir den schnippischen Unterton nicht verkneifen und wieso hätte ich auch, er war schließlich auch nicht unbedingt dass, was man einen Ausbund an Freundlichkeit nannte. Stumm blickte ich durch die geöffnete Haustür in den Flur. Alles sah so aus wie immer. Wäre ich nicht selbst dabei gewesen, als man Collin zu Grabe getragen hätte, ich hätte nicht gedacht, dass er tot wäre. Sein Geist, seine Seele oder wie man es auch immer nennen mochte, schien immer noch hier zu sein. Ein seltsames Gefühl durchlief meinen Körper, als ich die Tür langsam zuzog, den Schlüssel ins Schloss steckte und die Vergangenheit verschloss. Gerne hätte ich mit meinem Herzen dasselbe getan. All die Erinnerungen weggeschlossen, auf dass sie mir nicht mehr weh tun konnten. Aber ich wusste, dass das unmöglich war. Collin würde für immer einen Platz in meinem Innersten haben. Ein kleiner wunder Fleck, der immer nur ihm gehören würde. Der mir immer Schmerzen bereiten würde, wann immer ich an ihn dachte. Schmerzen, die ich gewohnt war. Denn ich hatte eine ganze Menge solcher wunden Flecken in mir.
Als ich mich umdrehte, stand Holly keine Armlänge von mir entfernt und Tränen rannen über ihre rosigen Wangen, wo ihre Wimperntusche schwarze Spuren hinterließ. Ich hatte keine Tränen für Holly übrig und das tat mir ein wenig leid. Ich mochte sie wirklich und war die letzten Jahre immer gerne in ihrer Nähe gewesen. Sie hatte ein einnehmendes Wesen und schaffte es binnen Sekunden, die Menschen in ihrer Umgebung zum Lachen zu bringen. Sie war ein sympathischer Mensch mit Ausstrahlung und ich war mir sicher, dass das Leben noch viele schöne Momente für sie bereit halten würde. Doch für mich war sie am Ende nicht mehr als ein Mensch von vielen, die ich bereits getroffen hatte und die ich wohl noch treffen würde. Wenn Zeit keine Rolle mehr spielt, werden auch die Begegnungen flüchtiger. Natürlich würde auch Holly ihre Spuren in mir hinterlassen, doch es waren Spuren, die verblassen würden, bis ich sie vergessen würde. Und so leid mir das auch tat, denn Holly hatte es nicht verdient vergessen zu werden, doch ändern konnte ich es nicht.
„Bitte pass gut auf dich auf.“ Ihre Stimme zitterte, da sie scheinbar gegen noch mehr Tränen ankämpfte.
Ich rang mir ein tapferes Lächeln ab, dann tat ich so, als würde ich frösteln, zog mir den Schal über die Hälfte meines Gesichtes und umarmte sie. „Mach ich. Und pass du ebenfalls auf dich auf.“
„Wirst du dich bei mir melden?“
„Natürlich.“ Es war gelogen und ich sah an Hollys Gesichtsausdruck, dass sie es ganz genau wusste. Ich glaube, sie hatte immer geahnt, dass irgendwas mit mir nicht stimmte, doch sie wusste nicht was es war. Sie wusste es auch jetzt nicht, sie wusste nur, dass ich log. Doch manchmal machte eine Lüge einem das Herz eben ein wenig leichter und Holly schien das genauso zu sehen. Ein letztes Mal drückte sie meine behandschuhte Hand, lächelte ebenfalls tapfer und dann ließ sie mich los, damit ich in das Taxi steigen und auf Nimmerwiedersehen davon fahren konnte.
„Zum Flughafen“, wies ich den unfreundlichen Fahrer mit unterkühlter Stimme an und blickte schließlich abweisend aus dem Fenster. Holly stand immer noch wie angewurzelt auf der Einfahrt meines ehemaligen Zuhauses. Die linke Hand hatte sie zum Abschiedsgruß gehoben. Der Motor wurde gestartet und der Wagen fuhr. Ich winkte ihr ebenfalls, während sie in der Ferne immer kleiner wurde und schließlich verschwand, als wir um eine Ecke bogen.
Mit einem leisen Seufzen lehnte ich mich zurück in die Polster. Einen Moment lang betrachtete ich die völlig verdreckte Wagendecke. Aus dem Augenwinkel sah ich die Häuser mit ihren niedlichen kleinen Vorgärten vorbei ziehen. „Adieu New Castle“, murmelte ich so leise, dass der Fahrer es nicht hörte. Mit einem leisen Ritsch öffnete ich die Handtasche auf meinem Schoß und begann darin zu wühlen. Der gefälschte Reisepass lag ganz oben. Joanna Brightham hieß es dort, sei vor 22 Jahren in London zur Welt gekommen. Das war natürlich völliger Quatsch, aber die Beamten am Flughafen würden mir wohl kaum abnehmen, wenn dort stünde ich sei im Jahre 1901 geboren. 1983 schien da schon logischer. Bei meinem ersten gefälschten Pass hatte ich sogar noch tatsächlich so etwas wie ein schlechtes Gewissen gehabt, aber mittlerweile empfand ich es als völlig normal, zu lügen das sich die Balken bogen. In dem Pass steckte mein Flugticket. New Castle, England – Orlando, Florida. Orlando, Florida – Seattle, Washington.
Zwei Tage hatte ich versucht mir einzureden, dass ich spann. Das mein Hirn mir nur einen bösen streich spielte. Eine Illusion, einen Wunsch vor Augen hielt. Dann hatte ich aufgegeben und entschieden, da Zeit für mich ja eh keine Rolle spielte, konnte ich mich genauso gut selbst davon überzeugen, dass ich langsam aber sicher durchdrehte. Ein psychisch kranker Vampir. Ob es sowas zuvor schon gegeben hatte? Ich wusste, dass mein Unterbewusstsein mir keine Ruhe lassen würde, also hatte ich kurzerhand einen Flug nach Seattle gebucht. Dort würde ich mir einen Wagen mieten, nach Forks fahren und diese High School suchen. Ich würde den Jungen vom Foto finden, wissen das es nicht Edward war und dann? Das würde ich dann entscheiden. Immer einen Schritt nach dem anderen gehen. Ich hatte schließlich keine Eile. Ein wenig spielte ich allerdings mit dem Gedanken, danach nach Chicago weiter zu fahren, die Stadt in der ich wirklich geboren war. Allerdings war ich mir ziemlich sicher, dass eine solche Unternehmung nur noch weitere wunde Flecken zum Schmerzen bringen würde. Trotzdem war es verlockend. Ich würde es wohl spontan entscheiden, beschloss ich.
Der Flug dauerte sehr lange und wurde schließlich unangenehm. Ich hatte dafür gesorgt, dass ich zuvor ausreichend getrunken hatte. Doch mit jeder Stunde die verging, wirkte die Halsschlagader meines Nebenmannes, der abstoßend nach Schweiß roch, anziehender. Mit beiden Händen umklammerte ich die Armlehnen meines Sitzes, schloss die Augen und versuchte mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Ich war den Geruch von Menschen gewöhnt, schließlich hatte ich schon sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Doch mein Durst war auch nach all diesen Jahren noch eine wilde Bestie, die ihren ganz eigenen Regeln folgte. Es ist ein wenig wie damals, als ich noch ein Kind war und meine Tante eine teure Schachtel Pralinen geschenkt bekommen hatte. Ich stibitzte eine kleine Leckerei, die keinem weiter aufgefallen wäre. Doch sobald der süße und zugleich bittere Geschmack meinen Gaumen erreicht hatte gab es kein Halten mehr. Ich aß und aß und aß, bis die Schachtel leer war und ich mir sehnlichst eine zweite herbei wünschte. Ebenso erging es mir mit dem Blut der Menschen. Ich hatte einmal ihr süßes Blut gekostet. Ich wusste wie es schmeckte und wie stark es mich machte. Und es war anstrengend, sich dem Drang zu wiedersetzen, es immer und immer wieder zu kosten. Zum ersten Mal empfand ich es als echten Nachteil, dass ich den Flug nicht einfach verschlafen konnte, wie es die meisten anderen Passagiere taten.
Nichts desto trotz gelang es mir irgendwie, mich zusammen zu reißen, so wie es mir sonst auch immer gelang, kein Massaker um mich herum anzurichten. Am Morgen erreichten wir endlich Seattle. Ich hielt mich nicht mit viel Geplänkel auf. Ich brauchte Blut und das am besten schnell und nicht von einem Menschen. Den Typen vom Mietwagenservice speiste ich mit einem „Geld spielt keine Rolle nur fix muss es gehen“ ab und saß eine knappe Stunde nach der Ladung hinter dem Steuer. Eigentlich hatte ich keinen Durst, nur Verlangen. Verlangen, dass gestillt werden wollte. Am nächstgelegenen Wald machte ich halt. Gewissenhaft sah ich mich um, dass ich auch wirklich alleine war und keine störenden Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs waren, dann rannte ich los. Wie ein geölter Blitz schoss ich durch das Unterholz, bis ich ihn sah. Er hatte mich gewittert, da war ich mir sicher. Zwischen zwei großen Bäumen standen wir uns gegenüber. Nieselregen plätscherte rhythmisch auf die Blätter über uns und durchnässten sowohl sein Fell als auch meine Haare und Kleidung. Tief sahen wir einander in die Augen, dann, ganz plötzlich machte er kehrt und rannte vor mir davon. Der Fuchs mochte vielleicht als das schlauste Tier im Wald gelten, aber ich war schneller. Kaum zehn Sekunden brauchte ich um ihn einzuholen und mein Verlangen an ihm zu stillen. Kurz und schmerzlos.
Erleichtert ging ich zurück zum Wagen und fuhr davon. Die Heizung stellte ich dabei auf höchste Stufe. Nicht weil mir kalt war, aber damit meine Kleidung und meine Haare trockneten. Ich wollte vermeiden, dass man mich für eine Rumtreiberin halten würde. Wahrscheinlich würde ich eh schon Argwohn erregen, wenn ich einfach so auf das Gelände einer mir völlig fremden Highschool spazierte. Aber was hatte ich schon groß zu verlieren? Selbst wenn ich Aufsehen erregte konnte ich immer noch flüchten und war über alle Berge, bevor jemand mich der versuchten Entführung oder dergleichen bezichtigen konnte. Ich erreichte Forks gegen Mittag. Der Regen hatte noch einmal mächtig zugelegt und dicke Tropfen trommelten auf das Dach des Mietwagens, den ich auf dem Parkplatz der Schule abgestellt hatte. Unschlüssig rutschte ich auf dem Fahrersitz herum. Was sollte ich als nächstes tun? Einfach in das Gebäude spazieren und hoffen, dass mir der Junge über den Weg lief?
Die Tür der Schule wurde aufgestoßen. Heraus kam eine große Gruppe Jugendlicher, die sich über den Platz, auf den Weg zur Sporthalle machte. Mit Argusaugen betrachtete ich jeden der Schüler und wurde fündig. Da war das Mädchen von den Fotos…
„Jo, du kannst doch jetzt nicht alles hinschmeißen und gehen. Das geht doch nicht. Ich meine, du kannst doch wenigstens erst mal das Studium zu Ende bringen.“ Ich seufzte verächtlich in meine Tasche. Ein Abschluss mehr oder weniger, was machte das schon aus? Ich verkniff mir den bissigen Kommentar, der mir auf der Zunge lag. Stattdessen prüfte ich noch einmal den Inhalt meines Koffers, klappte dann den Deckel zu und verschloss ihn. „Und was ist überhaupt mit dem Haus und den ganzen Sachen? Du kannst doch nicht einfach die Tür hinter dir zuziehen und das war´s.“
Da hatte sie Recht. Das hatte ich auch nicht vor, obwohl ich es gekonnt hätte. Das Haus war Collins und somit auch mein Eigentum gewesen und kostete mich von daher nicht einen lächerlichen Penny. Ich war mir noch nicht schlüssig, was genau ich mit dem Grundstück und den damit verbundenen Erinnerungen vorhatte. Im Moment wollte ich allerdings nur weg. „Ich kümmere mich um das Haus, sobald ich weiß wie es weitergeht und wo ich bleibe.“ Mit einem sanften Ruck zog ich den Koffer vom Bett, wobei ich so tat, als müsste ich mich wahnsinnig anstrengen. Mit einem leisen Knall landete das Reiseutensil auf dem Fußboden, wo ich den Zuggriff herauszog, um meine perfekte Scharade aufrecht zu erhalten. Ich hätte mir das Teil natürlich auch ebenso gut unter den Arm klemmen und mit Leichtigkeit in den Kofferraum des wartenden Taxis werfen können.
„Und wieso eigentlich Amerika? Kennst du irgendwen in Amerika? Hast du da Freunde oder Verwandte?“ Mich überkam das leichte Gefühl, dass Holly einem Nervenzusammenbruch nicht mehr all´ zu fern war, so schnell sprudelten die Fragen über ihre ungewöhnlich blassen Lippen. Blieb nur zu hoffen, dass sie sich nicht noch auf den Boden warf und mich anflehte nicht zu gehen oder irgendein anderes Drama in diese Richtung veranstaltete.
Ich konnte natürlich verstehen, dass sie sich Sorgen machte. Sie war schließlich der festen Auffassung, dass meine Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen, als ich noch ein kleines Mädchen war und das ich seit dem bei meinem Großvater gelebt hatte, da ich keine anderen Verwandten hatte. Wie sollte ich ihr denn erklären, dass ich mich in die Wahnvorstellung verrannt hatte, meinen Cousin, der vor 87 Jahre verstorben war, auf einem Foto im Internet gesehen zu haben. „Ich äh… ich habe Bekannte in… äh… Seattle“, log ich ziemlich plump. Aber selbst wenn ich der Wahrheit entsprechend irgendwelche Verwandten in den Vereinigten Staaten hätte aufweisen können, hätte ich Holly damit auch nicht beruhigen können. Von daher spielte es keine Rolle was ich zu ihr sagte.
Ich zog den Koffer hinter mir her auf den Flur, wo ich die Verkleidung des Sicherungskastens abnahm und die Stromzuvor des Hauses abstellte. Ein letztes Mal sah ich zurück. Zurück auf ein Dasein, das mir fast wie ein Leben vorgekommen war. Zurück auf eine Existenz, die ich so nie wieder erleben würde. Ich atmete tief ein und aus, dann drehte ich mir zur Haustür, um alles was gewesen war hinter mir zu lassen. Ich hatte die Tür schon fast erreicht. Ein Schritt noch, den Arm ausstrecken, die Klinke runter drücken, die Tür öffnen, hinaus treten und die Tür wieder hinter mir zuziehen. Dann hätte ich es geschafft. „Jo!“ Hollys Hand griff mich an der Schulter und ich blieb stehen um mich ihr und damit auch wieder der Vergangenheit zuzuwenden. „Deine Jacke!“ Besorgt sah sie mich an, den schwarzen Mantel in ihren verkrampften Fingern. „Du bist ja völlig durcheinander. DU solltest wirklich hier bleiben.“
„Es geht mir gut.“ Ich rang ein mühsames Lächeln auf mein Gesicht und löste die Finger meiner Freundin von dem so unnötigen, wärmenden Kleidungsstück, um hinein zu schlüpfen. Ich nahm die Handschuhe, den Schal und die Mütze, die Holly mir reichte ebenfalls entgegen und kleidete mich wintergerecht ein. „Mach dir bitte keine Sorgen um mich. Ich komm schon klar. Und nun komm.“ Geschützt durch die Handschuhe konnte ich ohne Probleme nach ihrer Hand greifen, um sie hinter mir her aus dem Haus zu ziehen. Ich wollte nun endlich weg von hier.
Der Taxifahrer hatte mit den Rücken an seinem Wagen gelehnt und zog nun eine Grimasse, die gleichzeitig seine Genervtheit zum Ausdruck brachte, da er so lange hatte warten müssen, als auch Erleichterung wiederspiegelte. „Na endlich“, teilte er ganz unverhohlen mit und riss mir den Koffer aus der Hand. „Der Taxameter läuft.“
„Das freut mich für sie. Das nennt man dann wohl leicht verdientes Geld.“ Ich konnte mir den schnippischen Unterton nicht verkneifen und wieso hätte ich auch, er war schließlich auch nicht unbedingt dass, was man einen Ausbund an Freundlichkeit nannte. Stumm blickte ich durch die geöffnete Haustür in den Flur. Alles sah so aus wie immer. Wäre ich nicht selbst dabei gewesen, als man Collin zu Grabe getragen hätte, ich hätte nicht gedacht, dass er tot wäre. Sein Geist, seine Seele oder wie man es auch immer nennen mochte, schien immer noch hier zu sein. Ein seltsames Gefühl durchlief meinen Körper, als ich die Tür langsam zuzog, den Schlüssel ins Schloss steckte und die Vergangenheit verschloss. Gerne hätte ich mit meinem Herzen dasselbe getan. All die Erinnerungen weggeschlossen, auf dass sie mir nicht mehr weh tun konnten. Aber ich wusste, dass das unmöglich war. Collin würde für immer einen Platz in meinem Innersten haben. Ein kleiner wunder Fleck, der immer nur ihm gehören würde. Der mir immer Schmerzen bereiten würde, wann immer ich an ihn dachte. Schmerzen, die ich gewohnt war. Denn ich hatte eine ganze Menge solcher wunden Flecken in mir.
Als ich mich umdrehte, stand Holly keine Armlänge von mir entfernt und Tränen rannen über ihre rosigen Wangen, wo ihre Wimperntusche schwarze Spuren hinterließ. Ich hatte keine Tränen für Holly übrig und das tat mir ein wenig leid. Ich mochte sie wirklich und war die letzten Jahre immer gerne in ihrer Nähe gewesen. Sie hatte ein einnehmendes Wesen und schaffte es binnen Sekunden, die Menschen in ihrer Umgebung zum Lachen zu bringen. Sie war ein sympathischer Mensch mit Ausstrahlung und ich war mir sicher, dass das Leben noch viele schöne Momente für sie bereit halten würde. Doch für mich war sie am Ende nicht mehr als ein Mensch von vielen, die ich bereits getroffen hatte und die ich wohl noch treffen würde. Wenn Zeit keine Rolle mehr spielt, werden auch die Begegnungen flüchtiger. Natürlich würde auch Holly ihre Spuren in mir hinterlassen, doch es waren Spuren, die verblassen würden, bis ich sie vergessen würde. Und so leid mir das auch tat, denn Holly hatte es nicht verdient vergessen zu werden, doch ändern konnte ich es nicht.
„Bitte pass gut auf dich auf.“ Ihre Stimme zitterte, da sie scheinbar gegen noch mehr Tränen ankämpfte.
Ich rang mir ein tapferes Lächeln ab, dann tat ich so, als würde ich frösteln, zog mir den Schal über die Hälfte meines Gesichtes und umarmte sie. „Mach ich. Und pass du ebenfalls auf dich auf.“
„Wirst du dich bei mir melden?“
„Natürlich.“ Es war gelogen und ich sah an Hollys Gesichtsausdruck, dass sie es ganz genau wusste. Ich glaube, sie hatte immer geahnt, dass irgendwas mit mir nicht stimmte, doch sie wusste nicht was es war. Sie wusste es auch jetzt nicht, sie wusste nur, dass ich log. Doch manchmal machte eine Lüge einem das Herz eben ein wenig leichter und Holly schien das genauso zu sehen. Ein letztes Mal drückte sie meine behandschuhte Hand, lächelte ebenfalls tapfer und dann ließ sie mich los, damit ich in das Taxi steigen und auf Nimmerwiedersehen davon fahren konnte.
„Zum Flughafen“, wies ich den unfreundlichen Fahrer mit unterkühlter Stimme an und blickte schließlich abweisend aus dem Fenster. Holly stand immer noch wie angewurzelt auf der Einfahrt meines ehemaligen Zuhauses. Die linke Hand hatte sie zum Abschiedsgruß gehoben. Der Motor wurde gestartet und der Wagen fuhr. Ich winkte ihr ebenfalls, während sie in der Ferne immer kleiner wurde und schließlich verschwand, als wir um eine Ecke bogen.
Mit einem leisen Seufzen lehnte ich mich zurück in die Polster. Einen Moment lang betrachtete ich die völlig verdreckte Wagendecke. Aus dem Augenwinkel sah ich die Häuser mit ihren niedlichen kleinen Vorgärten vorbei ziehen. „Adieu New Castle“, murmelte ich so leise, dass der Fahrer es nicht hörte. Mit einem leisen Ritsch öffnete ich die Handtasche auf meinem Schoß und begann darin zu wühlen. Der gefälschte Reisepass lag ganz oben. Joanna Brightham hieß es dort, sei vor 22 Jahren in London zur Welt gekommen. Das war natürlich völliger Quatsch, aber die Beamten am Flughafen würden mir wohl kaum abnehmen, wenn dort stünde ich sei im Jahre 1901 geboren. 1983 schien da schon logischer. Bei meinem ersten gefälschten Pass hatte ich sogar noch tatsächlich so etwas wie ein schlechtes Gewissen gehabt, aber mittlerweile empfand ich es als völlig normal, zu lügen das sich die Balken bogen. In dem Pass steckte mein Flugticket. New Castle, England – Orlando, Florida. Orlando, Florida – Seattle, Washington.
Zwei Tage hatte ich versucht mir einzureden, dass ich spann. Das mein Hirn mir nur einen bösen streich spielte. Eine Illusion, einen Wunsch vor Augen hielt. Dann hatte ich aufgegeben und entschieden, da Zeit für mich ja eh keine Rolle spielte, konnte ich mich genauso gut selbst davon überzeugen, dass ich langsam aber sicher durchdrehte. Ein psychisch kranker Vampir. Ob es sowas zuvor schon gegeben hatte? Ich wusste, dass mein Unterbewusstsein mir keine Ruhe lassen würde, also hatte ich kurzerhand einen Flug nach Seattle gebucht. Dort würde ich mir einen Wagen mieten, nach Forks fahren und diese High School suchen. Ich würde den Jungen vom Foto finden, wissen das es nicht Edward war und dann? Das würde ich dann entscheiden. Immer einen Schritt nach dem anderen gehen. Ich hatte schließlich keine Eile. Ein wenig spielte ich allerdings mit dem Gedanken, danach nach Chicago weiter zu fahren, die Stadt in der ich wirklich geboren war. Allerdings war ich mir ziemlich sicher, dass eine solche Unternehmung nur noch weitere wunde Flecken zum Schmerzen bringen würde. Trotzdem war es verlockend. Ich würde es wohl spontan entscheiden, beschloss ich.
Der Flug dauerte sehr lange und wurde schließlich unangenehm. Ich hatte dafür gesorgt, dass ich zuvor ausreichend getrunken hatte. Doch mit jeder Stunde die verging, wirkte die Halsschlagader meines Nebenmannes, der abstoßend nach Schweiß roch, anziehender. Mit beiden Händen umklammerte ich die Armlehnen meines Sitzes, schloss die Augen und versuchte mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Ich war den Geruch von Menschen gewöhnt, schließlich hatte ich schon sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Doch mein Durst war auch nach all diesen Jahren noch eine wilde Bestie, die ihren ganz eigenen Regeln folgte. Es ist ein wenig wie damals, als ich noch ein Kind war und meine Tante eine teure Schachtel Pralinen geschenkt bekommen hatte. Ich stibitzte eine kleine Leckerei, die keinem weiter aufgefallen wäre. Doch sobald der süße und zugleich bittere Geschmack meinen Gaumen erreicht hatte gab es kein Halten mehr. Ich aß und aß und aß, bis die Schachtel leer war und ich mir sehnlichst eine zweite herbei wünschte. Ebenso erging es mir mit dem Blut der Menschen. Ich hatte einmal ihr süßes Blut gekostet. Ich wusste wie es schmeckte und wie stark es mich machte. Und es war anstrengend, sich dem Drang zu wiedersetzen, es immer und immer wieder zu kosten. Zum ersten Mal empfand ich es als echten Nachteil, dass ich den Flug nicht einfach verschlafen konnte, wie es die meisten anderen Passagiere taten.
Nichts desto trotz gelang es mir irgendwie, mich zusammen zu reißen, so wie es mir sonst auch immer gelang, kein Massaker um mich herum anzurichten. Am Morgen erreichten wir endlich Seattle. Ich hielt mich nicht mit viel Geplänkel auf. Ich brauchte Blut und das am besten schnell und nicht von einem Menschen. Den Typen vom Mietwagenservice speiste ich mit einem „Geld spielt keine Rolle nur fix muss es gehen“ ab und saß eine knappe Stunde nach der Ladung hinter dem Steuer. Eigentlich hatte ich keinen Durst, nur Verlangen. Verlangen, dass gestillt werden wollte. Am nächstgelegenen Wald machte ich halt. Gewissenhaft sah ich mich um, dass ich auch wirklich alleine war und keine störenden Spaziergänger mit ihren Hunden unterwegs waren, dann rannte ich los. Wie ein geölter Blitz schoss ich durch das Unterholz, bis ich ihn sah. Er hatte mich gewittert, da war ich mir sicher. Zwischen zwei großen Bäumen standen wir uns gegenüber. Nieselregen plätscherte rhythmisch auf die Blätter über uns und durchnässten sowohl sein Fell als auch meine Haare und Kleidung. Tief sahen wir einander in die Augen, dann, ganz plötzlich machte er kehrt und rannte vor mir davon. Der Fuchs mochte vielleicht als das schlauste Tier im Wald gelten, aber ich war schneller. Kaum zehn Sekunden brauchte ich um ihn einzuholen und mein Verlangen an ihm zu stillen. Kurz und schmerzlos.
Erleichtert ging ich zurück zum Wagen und fuhr davon. Die Heizung stellte ich dabei auf höchste Stufe. Nicht weil mir kalt war, aber damit meine Kleidung und meine Haare trockneten. Ich wollte vermeiden, dass man mich für eine Rumtreiberin halten würde. Wahrscheinlich würde ich eh schon Argwohn erregen, wenn ich einfach so auf das Gelände einer mir völlig fremden Highschool spazierte. Aber was hatte ich schon groß zu verlieren? Selbst wenn ich Aufsehen erregte konnte ich immer noch flüchten und war über alle Berge, bevor jemand mich der versuchten Entführung oder dergleichen bezichtigen konnte. Ich erreichte Forks gegen Mittag. Der Regen hatte noch einmal mächtig zugelegt und dicke Tropfen trommelten auf das Dach des Mietwagens, den ich auf dem Parkplatz der Schule abgestellt hatte. Unschlüssig rutschte ich auf dem Fahrersitz herum. Was sollte ich als nächstes tun? Einfach in das Gebäude spazieren und hoffen, dass mir der Junge über den Weg lief?
Die Tür der Schule wurde aufgestoßen. Heraus kam eine große Gruppe Jugendlicher, die sich über den Platz, auf den Weg zur Sporthalle machte. Mit Argusaugen betrachtete ich jeden der Schüler und wurde fündig. Da war das Mädchen von den Fotos…
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 9
Vorsichtig sank ich in meinem Sitz ein Stückchen tiefer, um nicht gesehen zu werden. Gleichzeitig ließ ich allerdings auch das Fenster ein Stück herunter, um ein paar Gesprächsfetzen mitzubekommen. Das Mädchen von den Fotos, Isabella war ihr Name, wurde von einem blonden Jüngling begleitet, der ihr geradezu an den Lippen zu hängen schien. Die Beinschiene, die sie auf den Fotos trug war verschwunden und ebenso fehlte von dem Jungen, der mich so wahnsinnig an Edward erinnert hatte jede Spur. Hatte ich ihn mir am Ende gar nur eingebildet? Eine Ausgeburt meiner Fantasie. Vielleicht war es der Schock über Collins Tod, der meinen Geist dazu gebracht hat sich zu verselbständigen und mir Dinge vorzutäuschen die am Ende gar nicht da waren.
„Trekking? Bei dem Wetter? Die spinnen doch!“ Der Wind trug das leise Stimmenwirrwar der Schüler zu mir herüber, aber wirkliche Sätze konnte ich nicht herausfiltern. Zwar hatte ich bessere Ohren als der gewöhnliche Mensch, aber wenn so viele Leute aufeinander einredeten – und das war in einer großen Gruppe Jugendlicher wohl kaum zu vermeiden – versagte auch mein Gehör. Trotzdem war ich mir ziemlich sicher, tatsächlich den Namen Edward herausgehört zu haben. Wahrheit oder Einbildung? Ich konnte es nicht sagen, trotzdem zuckte ich merklich zusammen. Ich rutschte noch ein wenig tiefer in die Polster, bis ich kaum mehr über das Lenkrad sehen konnte. Das war aber auch nicht nötig. Die Gruppe hatte nämlich inzwischen die Sporthalle erreicht und floh vor dem immer stärker werdenden Regen im Inneren.
Unschlüssig, was ich als nächstes tun sollte, verharrte ich eine ganze Zeit lang in meiner Kauerstellung und starte durch die Windschutzscheibe. Der Regen war nun zu einem richtigen Schauer angeschwollen. Dicke Tropfen sammelten sich am obersten Rand der Scheibe, um dann als kleines Rinnsal herunter zu fließen und auf der Motorhaube zu verschwinden. Ich beobachtete gerne den Regen. Genau wie in Büchern, konnte ich mich in der Betrachtung der Natur verlieren. Aber jetzt quälte mich nur eine einzige Frage: Wo steckte der Bursche von den Bildern. Ich hatte ihn mir nicht eingebildet, da war ich mir sicher. Aber wieso zum Teufel war ich davon ausgegangen, dass er hier war? Vielleicht ging er überhaupt nicht auf diese Schule und hatte lediglich seine Freundin zu dieser Party begleitet. Daran war ja nun wirklich nichts Ungewöhnliches.
Vielleicht war er noch nicht einmal ihr Freund. Holly hatte diese schlimme Angewohnheit gehabt ihren nicht gerade liebenswerten Halbbruder überall mit hinzuschleppen, in der Hoffnung, er würde endlich mal ein paar Freunde finden. Ein Vorhaben das natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Wer auch immer dieser Junge war, er war ganz sicher nicht Edward gewesen. Es war eine völlig blöde und überaus hirnrissige Idee von mir gewesen überhaupt herzukommen. Und dennoch wollte ein mikroskopisch kleiner Teil meines Herzens an der Hoffnung festhalten, das es irgendwo dort draußen noch jemanden gab, den ich liebte. Ich war keine dumme Person, aber manchmal veranlasst unsere Sehnsucht uns einfach dazu völlig dämliche Dinge zu tun, wie zum Beispiel einem Phantom hinter her zu jagen.
Wütend auf mich selbst stieß ich die Fahrertür auf und stieg aus dem Wagen. Tief atmete ich die kalte, nasse Luft in meine toten Lungen, während ich meinen Blick über das Gelände schweifen ließ. Die Forks Highschool war nur eine kleine Schule in einer winzigen Stadt. Es gab das Hauptgebäude, die Sporthalle und die kleine Cafeteria, vor der ein paar Picknicktische standen, damit die Schüler ihre Mahlzeiten im Sommer draußen einnehmen konnten. Neben dem Parkplatz führte die Hauptverkehrsstraße durch den kleinen Ort. Und hinter dem Schulgelände erstreckte sich ein riesiger Wald, der sich einen Berg hinaufwand, dessen Gipfel ich durch die dicke Wolkendecke nicht ausmachen konnte. Vorsichtig drehte ich mich einmal zu allen Seiten, um sicher zu gehen, dass sich auch alle Schüler im Unterricht befanden, dann rannte ich los. Binnen weniger Sekunden hatte ich den Waldrand erreicht und verschwand im Dickicht der Tannen.
Mit wilder Entschlossenheit versuchte ich all meine Wut und Verzweiflung aus mir heraus zu rennen. So schnell ich konnte rannte ich den Berg hinauf, schräg wieder hinunter und auf einer anderen Seite hinauf. Von der Vielfalt der Bäume und Pflanzen nahm ich dabei natürlich nichts wahr. Wie von Blindheit geschlagen war ich zu nichts anderem in der Lage, als mich völlig auf meine innere Unruhe zu konzentrieren. Dornenbüsche streiften meine Beine und zerrissen mir die völlig durchnässte Hose, doch die blasse Haut ließen sie unversehrt. Zurückschnellende Äste schlugen mir gegen die Arme und gegen das Gesicht, ohne auch nur die kleinsten Blessuren zu hinterlassen. Schlimmer noch, ich nahm die Schläge, die für einen Menschen sehr unangenehm gewesen wäre, kaum wahr. Doch das machte mich nur noch wütender. Ich wollte es fühlen. Ich wollte das Leben fühlen. Doch in mir war kein Leben. Nur ein einsames Herz das verzweifelt schrie und für immer schreien würde. Für immer und Ewig. Denn ich war gefangen im Tod, der mich am Leben hielt. Wie schon so manches Mal zuvor wünschte ich mir in diesem Augenblick, dass ich sterben könnte, wie alle anderen auch. Dass ich aus der Pflicht des Lebens entlassen wurde und nicht mehr denken und fühlen konnte. Doch Gott trieb nun schon so lange seine grausamen Spiele mit mir, das mir klar war, dass dieser Wunsch niemals in Erfüllung gehen würde.
Ich kann nicht sagen, wie lange ich lief. Vielleicht waren es nur ein paar Minuten, eventuell aber auch Stunden. Am unteren Rand des Berges blieb ich schließlich stehen, weil der Wind wieder Stimmen zu mir herüber trug. Die Schule war aus und die Schüler strömten aus dem Gebäude zu ihren Autos und Fahrrädern. Unter ihnen war auch Isabella, die vor einem alten, rostigen Pickup stand und sich mit ein paar Freunden unterhielt, bevor sie in den Wagen stieg. Der Motor heulte beim Start laut auf und der Auspuff gab ein leicht knatterndes Geräusch von sich. Umsichtig und langsam schob sich das altersschwache Gefährt erst aus der Parklücke und dann vom Platz. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was ich tun sollte, aber eines war mir völlig klar: Wenn ich sie nun davon fahren ließ, würde ich niemals mehr über den Jungen auf den Fotos erfahren. Aber was sollte ich sonst tun? Sie verfolgen? Verunsichert blickte ich zu meinem überteuerten Leihwagen, dessen silberne Lackierung so neu blitze, dass er selbst auf diese Entfernung nicht gerade unauffällig war. Wenn ich ihr darin hinterher fuhr, würde sie doch nach kürzester Zeit Lunte riechen und wahrscheinlich direkt zur Polizei rennen.
Nachdenklich stemmte ich die Hände in die Hüften und kaute auf meiner Unterlippe herum, wie ich es bereits als kleines Kind zu tun gepflegt hatte, wenn ich mir nicht im Klaren darüber warm, wie ich mich verhalten sollten. Den Roten Transporter ließ ich dabei nicht aus den Augen. Mit Schrittgeschwindigkeit tastete sich die Fahrerin zum Rande des Parkplatzes vor und bog dann auf die Straße ab. Ich fasste den Entschluss blitzartig. Die Straße ging direkt am Wald entlang. In meinem Wagen war ich zu auffällig, aber zu Fuß und im Schutze der Bäume, würde sie mich nicht bemerken. Obwohl ich wusste, dass es eine Schnapsidee war und obwohl ich mit keinerlei Erfolg rechnete, etwas über den Jungen zu erfahren rannte ich los. Geschützt durch die Böschung, folgte ich dem fahrenden Auto mehrere Kilometer, tiefer in den Wald. Bis hinter einer Weggabelung plötzlich ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite auftauchte.
Im Schatten einer riesigen Kastanie konnte ich genau beobachten, wie das Mädchen aus ihrem Auto stieg, die paar Stufen erklomm und klingelte. Kaum zwei Sekunden vergingen, bis die Tür geöffnet wurde. Leider konnte ich die Person in der Tür nicht sehen, vielleicht war es der Junge? Doch ich vernahm ganz deutlich eine weibliche Stimme. „Bella! Schön das du hier bist. Die drei sind leider noch nicht zurück. Sie sind gestern etwas verspätet aufgebrochen, weil Emmet und Rosalie zurückgekommen sind. Ist das nicht wunderbar? Aber komm doch rein. Lange werden sie sicher nicht mehr weg sein.“ Isabella Swans brauner Haarschopf verschwand im Haus und die Tür wurde wieder verschlossen. Und wieder einmal blieb ich unschlüssig und genauso wenig schlau wie zuvor zurück. Wenn ich bis zum Abend nichts über den Burschen herausgefunden hatte, würde ich mich nach New York aufmachen und der ganzen Sache keinerlei Beachtung mehr schenken, dass schwor ich mir.
Aber obwohl es bereits dunkel wurde, war es noch Nachmittag und mir blieben noch ein paar Stunden zeit. Lautlos huschte ich über die Straße, in den Wald hinter dem Haus. Tunlichst darauf bedacht, von niemandem gesehen zu werden. Weder kannte ich diese Leute, noch wollte ich ihnen irgendetwas böses, weshalb ich vermeiden wollte, dass sie sich in irgendeiner Weise bedroht fühlten. In ein paar Stunden würde ich den Highway entlang fahren und niemand würde jemals erfahren, dass ich hier wahr und wie eine Geistesgestörte, wildfremde Leute beschattet hatte.
Aus einem Zimmer im unteren Stockwerk drang Licht nach draußen. Es handelte sich dabei eindeutig um das Wohnzimmer. Ein besonders geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer. Hier schien jemand ordentlich Geld zu haben. Mir stach allerdings als erstes der riesige, schwarze Flügel ins Auge. Er erinnerte mich an Edward, den ich sofort noch viel schmerzlicher vermisste, als je zuvor in meinem Leben. Auf einem großen Designersofa saßen drei Personen, die mir allerdings den Rücken zugedreht hatten. An ihren Frisuren konnte ich jedoch erkennen, dass es sich um zwei Männer und eine Frau handelte. Isabella saß in einem Sessel auf der rechten Seite des Sofas und lächelte nervös. Zwar schien das Mädchen hier nicht zuhause zu sein und sich auch nicht unbedingt pudelwohl zu fühlen, aber sie schien sich in ihrem Verhalten relativ sicher zu sein. Scheinbar hatte sie jemanden besuchen wollen, der nicht da war und auf diese Person wartete sie nun. Besser gesagt drei Personen. Davon hatte zumindest die Frau an der Tür gesprochen. Hier gab es definitiv nichts Außergewöhnliches zu sehen und erst recht nichts, das für mich hätte von Interesse sein können.
Was dann allerdings geschah überraschte mich sehr. Ich hatte so gebannt die Szene im Wohnzimmer beobachtete, das ich niemanden die Haustür hatte öffnen hören. Doch plötzlich flog die Tür zum Wohnzimmer auf und zwei Männer sowie eine junge Frau stürmten herein. Ihre Haare und ihre Kleidung waren völlig durchnässt. Sie mussten von draußen gekommen sein. Die Spannung die augenblicklich herrschte, war auch von meinem Versteck aus zu spüren. Einer der Männer riss Isabella an sich, die junge Frau sagte etwas und alle anderen sprangen auf. Eine weitere Frau betrat rasend schnell das Zimmer. Ihre Bewegungen machten mich stutzig. So bewegten sich Menschen nicht. So bewegten sich Vampire. Und dann wandte der Mann, der Isabella immer noch fest gepackt hielt seinen Blick auf die große Scheibe. Währe es mir möglich gewesen, so währe ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Auf jeden Fall kam es mir so vor, als würden meine Knie plötzlich nachgeben. „Edward!“, presste ich geschockt hervor. Nun schienen alle Anwesenden ihren Blick auf mich gerichtet zu haben.
Dann sprinteten zwei auf einmal los. Ein ziemlich großer Mann mit dunklem Haar und ein etwas kleinerer, mit blonden Haaren. Ich konnte gar nicht so schnell begreifen was geschah, da hatten sie auch schon die Tür nach draußen aufgerissen. Ihre Mienen hasserfüllt und wütend, rannten sie genau in meine Richtung. Ich folgte einem blinden Instinkt. Obwohl ich wusste das es zwecklos war, rannte ich tiefer in Wald und weg von diesen Männern, die auf mich den Eindruck machten, als würden sie mir jeden Moment den Kopf abreißen. Ich lief, so schnell mich meine Beine trugen, doch sie waren nicht nur zu zweit, sondern auch noch viel schneller als ich. „Für einen Vampir bist du ganz schön langsam“, zischte der Größere und bekam meinen rechten Arm zu fassen. Er tat mir nicht direkt weh, aber ich konnte deutlich spüren, wie viel stärker er war.
„Für einen Vampir bist du ganz schön fett“, konterte ich und versuchte meinen Angreifer mit einem Fausthieb nieder zu strecken. Natürlich gelang es mir nicht. Trotzdem schlug ich ein weiteres Mal zu, in der Hoffnung ihn wenigstens so sehr zu irritieren, dass er mich losließ. Doch da ergriff der andere bereits meinen linken Arm und ich saß in der Falle.
„Meinst du, dass ist die Frau aus Alice Vision?“, fragte der größere seinen Kumpanen, der mich gefährlich anknurrte, als ich versuchte nach ihm zu treten.
„Ich habe keine Ahnung. Das kann uns wohl nur Alice sagen. Auf jeden Fall hat sie Bella beobachtet.“
„Lasst mich los!“ Völlig verzweifelt fing ich an, nach den beiden zu schnappen. Der größere drehte meinen Arm auf den Rücken, damit er hinter mir stehen konnte.
„Den Teufel werde ich tun. Nicht bevor du uns gesagt hast, wieso du hier rumstreunst und Bella verfolgst.“ Im Klammergriff führte mich der Größere wieder Richtung Haus. Ich versuchte unterdessen dieses Unterfangen, so schwer wie möglich für ihn zu machen. Ich lehnte mich gegen ihn, trat nach ihm und wand mich in seinem Griff, egal wie nutzlos es war.
„Bitte. Ich wollte niemandem etwas Böses. Wirklich nicht.“
„Nun denn. Wir wollen auch niemandem etwas Böses. Dann sind wir uns ja einig.“ Mit einem gekonnten Tritt in die Rippen verfrachtete mich der Vampir auf seinen Arm, wo er mich fest umklammert hielt, während er mich zum Haus trug. Ich gab es auf, mich zu wehren. Binnen Sekunden hatten wir das Haus erreicht und wurde in das Wohnzimmer getragen, fünf zähnefletschende Vampire Aufstellung vor Isabella genommen hatten, als müssten sie sie vor mir beschützen. Der Riese stellte mich auf den Boden ab, hielt aber meinen rechten Arm umklammert, während der Blonde wieder meinen linken erfasste. Und dort stand ich nun. Wie eine Gefangene. Und ich blickte in ein paar goldbraune Augen, die früher einmal das leuchtender Grün einer Katze gehabt hatten und mich nun zornig anblitzten.
Vorsichtig sank ich in meinem Sitz ein Stückchen tiefer, um nicht gesehen zu werden. Gleichzeitig ließ ich allerdings auch das Fenster ein Stück herunter, um ein paar Gesprächsfetzen mitzubekommen. Das Mädchen von den Fotos, Isabella war ihr Name, wurde von einem blonden Jüngling begleitet, der ihr geradezu an den Lippen zu hängen schien. Die Beinschiene, die sie auf den Fotos trug war verschwunden und ebenso fehlte von dem Jungen, der mich so wahnsinnig an Edward erinnert hatte jede Spur. Hatte ich ihn mir am Ende gar nur eingebildet? Eine Ausgeburt meiner Fantasie. Vielleicht war es der Schock über Collins Tod, der meinen Geist dazu gebracht hat sich zu verselbständigen und mir Dinge vorzutäuschen die am Ende gar nicht da waren.
„Trekking? Bei dem Wetter? Die spinnen doch!“ Der Wind trug das leise Stimmenwirrwar der Schüler zu mir herüber, aber wirkliche Sätze konnte ich nicht herausfiltern. Zwar hatte ich bessere Ohren als der gewöhnliche Mensch, aber wenn so viele Leute aufeinander einredeten – und das war in einer großen Gruppe Jugendlicher wohl kaum zu vermeiden – versagte auch mein Gehör. Trotzdem war ich mir ziemlich sicher, tatsächlich den Namen Edward herausgehört zu haben. Wahrheit oder Einbildung? Ich konnte es nicht sagen, trotzdem zuckte ich merklich zusammen. Ich rutschte noch ein wenig tiefer in die Polster, bis ich kaum mehr über das Lenkrad sehen konnte. Das war aber auch nicht nötig. Die Gruppe hatte nämlich inzwischen die Sporthalle erreicht und floh vor dem immer stärker werdenden Regen im Inneren.
Unschlüssig, was ich als nächstes tun sollte, verharrte ich eine ganze Zeit lang in meiner Kauerstellung und starte durch die Windschutzscheibe. Der Regen war nun zu einem richtigen Schauer angeschwollen. Dicke Tropfen sammelten sich am obersten Rand der Scheibe, um dann als kleines Rinnsal herunter zu fließen und auf der Motorhaube zu verschwinden. Ich beobachtete gerne den Regen. Genau wie in Büchern, konnte ich mich in der Betrachtung der Natur verlieren. Aber jetzt quälte mich nur eine einzige Frage: Wo steckte der Bursche von den Bildern. Ich hatte ihn mir nicht eingebildet, da war ich mir sicher. Aber wieso zum Teufel war ich davon ausgegangen, dass er hier war? Vielleicht ging er überhaupt nicht auf diese Schule und hatte lediglich seine Freundin zu dieser Party begleitet. Daran war ja nun wirklich nichts Ungewöhnliches.
Vielleicht war er noch nicht einmal ihr Freund. Holly hatte diese schlimme Angewohnheit gehabt ihren nicht gerade liebenswerten Halbbruder überall mit hinzuschleppen, in der Hoffnung, er würde endlich mal ein paar Freunde finden. Ein Vorhaben das natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Wer auch immer dieser Junge war, er war ganz sicher nicht Edward gewesen. Es war eine völlig blöde und überaus hirnrissige Idee von mir gewesen überhaupt herzukommen. Und dennoch wollte ein mikroskopisch kleiner Teil meines Herzens an der Hoffnung festhalten, das es irgendwo dort draußen noch jemanden gab, den ich liebte. Ich war keine dumme Person, aber manchmal veranlasst unsere Sehnsucht uns einfach dazu völlig dämliche Dinge zu tun, wie zum Beispiel einem Phantom hinter her zu jagen.
Wütend auf mich selbst stieß ich die Fahrertür auf und stieg aus dem Wagen. Tief atmete ich die kalte, nasse Luft in meine toten Lungen, während ich meinen Blick über das Gelände schweifen ließ. Die Forks Highschool war nur eine kleine Schule in einer winzigen Stadt. Es gab das Hauptgebäude, die Sporthalle und die kleine Cafeteria, vor der ein paar Picknicktische standen, damit die Schüler ihre Mahlzeiten im Sommer draußen einnehmen konnten. Neben dem Parkplatz führte die Hauptverkehrsstraße durch den kleinen Ort. Und hinter dem Schulgelände erstreckte sich ein riesiger Wald, der sich einen Berg hinaufwand, dessen Gipfel ich durch die dicke Wolkendecke nicht ausmachen konnte. Vorsichtig drehte ich mich einmal zu allen Seiten, um sicher zu gehen, dass sich auch alle Schüler im Unterricht befanden, dann rannte ich los. Binnen weniger Sekunden hatte ich den Waldrand erreicht und verschwand im Dickicht der Tannen.
Mit wilder Entschlossenheit versuchte ich all meine Wut und Verzweiflung aus mir heraus zu rennen. So schnell ich konnte rannte ich den Berg hinauf, schräg wieder hinunter und auf einer anderen Seite hinauf. Von der Vielfalt der Bäume und Pflanzen nahm ich dabei natürlich nichts wahr. Wie von Blindheit geschlagen war ich zu nichts anderem in der Lage, als mich völlig auf meine innere Unruhe zu konzentrieren. Dornenbüsche streiften meine Beine und zerrissen mir die völlig durchnässte Hose, doch die blasse Haut ließen sie unversehrt. Zurückschnellende Äste schlugen mir gegen die Arme und gegen das Gesicht, ohne auch nur die kleinsten Blessuren zu hinterlassen. Schlimmer noch, ich nahm die Schläge, die für einen Menschen sehr unangenehm gewesen wäre, kaum wahr. Doch das machte mich nur noch wütender. Ich wollte es fühlen. Ich wollte das Leben fühlen. Doch in mir war kein Leben. Nur ein einsames Herz das verzweifelt schrie und für immer schreien würde. Für immer und Ewig. Denn ich war gefangen im Tod, der mich am Leben hielt. Wie schon so manches Mal zuvor wünschte ich mir in diesem Augenblick, dass ich sterben könnte, wie alle anderen auch. Dass ich aus der Pflicht des Lebens entlassen wurde und nicht mehr denken und fühlen konnte. Doch Gott trieb nun schon so lange seine grausamen Spiele mit mir, das mir klar war, dass dieser Wunsch niemals in Erfüllung gehen würde.
Ich kann nicht sagen, wie lange ich lief. Vielleicht waren es nur ein paar Minuten, eventuell aber auch Stunden. Am unteren Rand des Berges blieb ich schließlich stehen, weil der Wind wieder Stimmen zu mir herüber trug. Die Schule war aus und die Schüler strömten aus dem Gebäude zu ihren Autos und Fahrrädern. Unter ihnen war auch Isabella, die vor einem alten, rostigen Pickup stand und sich mit ein paar Freunden unterhielt, bevor sie in den Wagen stieg. Der Motor heulte beim Start laut auf und der Auspuff gab ein leicht knatterndes Geräusch von sich. Umsichtig und langsam schob sich das altersschwache Gefährt erst aus der Parklücke und dann vom Platz. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was ich tun sollte, aber eines war mir völlig klar: Wenn ich sie nun davon fahren ließ, würde ich niemals mehr über den Jungen auf den Fotos erfahren. Aber was sollte ich sonst tun? Sie verfolgen? Verunsichert blickte ich zu meinem überteuerten Leihwagen, dessen silberne Lackierung so neu blitze, dass er selbst auf diese Entfernung nicht gerade unauffällig war. Wenn ich ihr darin hinterher fuhr, würde sie doch nach kürzester Zeit Lunte riechen und wahrscheinlich direkt zur Polizei rennen.
Nachdenklich stemmte ich die Hände in die Hüften und kaute auf meiner Unterlippe herum, wie ich es bereits als kleines Kind zu tun gepflegt hatte, wenn ich mir nicht im Klaren darüber warm, wie ich mich verhalten sollten. Den Roten Transporter ließ ich dabei nicht aus den Augen. Mit Schrittgeschwindigkeit tastete sich die Fahrerin zum Rande des Parkplatzes vor und bog dann auf die Straße ab. Ich fasste den Entschluss blitzartig. Die Straße ging direkt am Wald entlang. In meinem Wagen war ich zu auffällig, aber zu Fuß und im Schutze der Bäume, würde sie mich nicht bemerken. Obwohl ich wusste, dass es eine Schnapsidee war und obwohl ich mit keinerlei Erfolg rechnete, etwas über den Jungen zu erfahren rannte ich los. Geschützt durch die Böschung, folgte ich dem fahrenden Auto mehrere Kilometer, tiefer in den Wald. Bis hinter einer Weggabelung plötzlich ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite auftauchte.
Im Schatten einer riesigen Kastanie konnte ich genau beobachten, wie das Mädchen aus ihrem Auto stieg, die paar Stufen erklomm und klingelte. Kaum zwei Sekunden vergingen, bis die Tür geöffnet wurde. Leider konnte ich die Person in der Tür nicht sehen, vielleicht war es der Junge? Doch ich vernahm ganz deutlich eine weibliche Stimme. „Bella! Schön das du hier bist. Die drei sind leider noch nicht zurück. Sie sind gestern etwas verspätet aufgebrochen, weil Emmet und Rosalie zurückgekommen sind. Ist das nicht wunderbar? Aber komm doch rein. Lange werden sie sicher nicht mehr weg sein.“ Isabella Swans brauner Haarschopf verschwand im Haus und die Tür wurde wieder verschlossen. Und wieder einmal blieb ich unschlüssig und genauso wenig schlau wie zuvor zurück. Wenn ich bis zum Abend nichts über den Burschen herausgefunden hatte, würde ich mich nach New York aufmachen und der ganzen Sache keinerlei Beachtung mehr schenken, dass schwor ich mir.
Aber obwohl es bereits dunkel wurde, war es noch Nachmittag und mir blieben noch ein paar Stunden zeit. Lautlos huschte ich über die Straße, in den Wald hinter dem Haus. Tunlichst darauf bedacht, von niemandem gesehen zu werden. Weder kannte ich diese Leute, noch wollte ich ihnen irgendetwas böses, weshalb ich vermeiden wollte, dass sie sich in irgendeiner Weise bedroht fühlten. In ein paar Stunden würde ich den Highway entlang fahren und niemand würde jemals erfahren, dass ich hier wahr und wie eine Geistesgestörte, wildfremde Leute beschattet hatte.
Aus einem Zimmer im unteren Stockwerk drang Licht nach draußen. Es handelte sich dabei eindeutig um das Wohnzimmer. Ein besonders geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer. Hier schien jemand ordentlich Geld zu haben. Mir stach allerdings als erstes der riesige, schwarze Flügel ins Auge. Er erinnerte mich an Edward, den ich sofort noch viel schmerzlicher vermisste, als je zuvor in meinem Leben. Auf einem großen Designersofa saßen drei Personen, die mir allerdings den Rücken zugedreht hatten. An ihren Frisuren konnte ich jedoch erkennen, dass es sich um zwei Männer und eine Frau handelte. Isabella saß in einem Sessel auf der rechten Seite des Sofas und lächelte nervös. Zwar schien das Mädchen hier nicht zuhause zu sein und sich auch nicht unbedingt pudelwohl zu fühlen, aber sie schien sich in ihrem Verhalten relativ sicher zu sein. Scheinbar hatte sie jemanden besuchen wollen, der nicht da war und auf diese Person wartete sie nun. Besser gesagt drei Personen. Davon hatte zumindest die Frau an der Tür gesprochen. Hier gab es definitiv nichts Außergewöhnliches zu sehen und erst recht nichts, das für mich hätte von Interesse sein können.
Was dann allerdings geschah überraschte mich sehr. Ich hatte so gebannt die Szene im Wohnzimmer beobachtete, das ich niemanden die Haustür hatte öffnen hören. Doch plötzlich flog die Tür zum Wohnzimmer auf und zwei Männer sowie eine junge Frau stürmten herein. Ihre Haare und ihre Kleidung waren völlig durchnässt. Sie mussten von draußen gekommen sein. Die Spannung die augenblicklich herrschte, war auch von meinem Versteck aus zu spüren. Einer der Männer riss Isabella an sich, die junge Frau sagte etwas und alle anderen sprangen auf. Eine weitere Frau betrat rasend schnell das Zimmer. Ihre Bewegungen machten mich stutzig. So bewegten sich Menschen nicht. So bewegten sich Vampire. Und dann wandte der Mann, der Isabella immer noch fest gepackt hielt seinen Blick auf die große Scheibe. Währe es mir möglich gewesen, so währe ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Auf jeden Fall kam es mir so vor, als würden meine Knie plötzlich nachgeben. „Edward!“, presste ich geschockt hervor. Nun schienen alle Anwesenden ihren Blick auf mich gerichtet zu haben.
Dann sprinteten zwei auf einmal los. Ein ziemlich großer Mann mit dunklem Haar und ein etwas kleinerer, mit blonden Haaren. Ich konnte gar nicht so schnell begreifen was geschah, da hatten sie auch schon die Tür nach draußen aufgerissen. Ihre Mienen hasserfüllt und wütend, rannten sie genau in meine Richtung. Ich folgte einem blinden Instinkt. Obwohl ich wusste das es zwecklos war, rannte ich tiefer in Wald und weg von diesen Männern, die auf mich den Eindruck machten, als würden sie mir jeden Moment den Kopf abreißen. Ich lief, so schnell mich meine Beine trugen, doch sie waren nicht nur zu zweit, sondern auch noch viel schneller als ich. „Für einen Vampir bist du ganz schön langsam“, zischte der Größere und bekam meinen rechten Arm zu fassen. Er tat mir nicht direkt weh, aber ich konnte deutlich spüren, wie viel stärker er war.
„Für einen Vampir bist du ganz schön fett“, konterte ich und versuchte meinen Angreifer mit einem Fausthieb nieder zu strecken. Natürlich gelang es mir nicht. Trotzdem schlug ich ein weiteres Mal zu, in der Hoffnung ihn wenigstens so sehr zu irritieren, dass er mich losließ. Doch da ergriff der andere bereits meinen linken Arm und ich saß in der Falle.
„Meinst du, dass ist die Frau aus Alice Vision?“, fragte der größere seinen Kumpanen, der mich gefährlich anknurrte, als ich versuchte nach ihm zu treten.
„Ich habe keine Ahnung. Das kann uns wohl nur Alice sagen. Auf jeden Fall hat sie Bella beobachtet.“
„Lasst mich los!“ Völlig verzweifelt fing ich an, nach den beiden zu schnappen. Der größere drehte meinen Arm auf den Rücken, damit er hinter mir stehen konnte.
„Den Teufel werde ich tun. Nicht bevor du uns gesagt hast, wieso du hier rumstreunst und Bella verfolgst.“ Im Klammergriff führte mich der Größere wieder Richtung Haus. Ich versuchte unterdessen dieses Unterfangen, so schwer wie möglich für ihn zu machen. Ich lehnte mich gegen ihn, trat nach ihm und wand mich in seinem Griff, egal wie nutzlos es war.
„Bitte. Ich wollte niemandem etwas Böses. Wirklich nicht.“
„Nun denn. Wir wollen auch niemandem etwas Böses. Dann sind wir uns ja einig.“ Mit einem gekonnten Tritt in die Rippen verfrachtete mich der Vampir auf seinen Arm, wo er mich fest umklammert hielt, während er mich zum Haus trug. Ich gab es auf, mich zu wehren. Binnen Sekunden hatten wir das Haus erreicht und wurde in das Wohnzimmer getragen, fünf zähnefletschende Vampire Aufstellung vor Isabella genommen hatten, als müssten sie sie vor mir beschützen. Der Riese stellte mich auf den Boden ab, hielt aber meinen rechten Arm umklammert, während der Blonde wieder meinen linken erfasste. Und dort stand ich nun. Wie eine Gefangene. Und ich blickte in ein paar goldbraune Augen, die früher einmal das leuchtender Grün einer Katze gehabt hatten und mich nun zornig anblitzten.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 10
Vor meinem geistigen Auge erhob sich die Erinnerung an einen zehnjährigen Knaben, der das Gesicht zu einer furchtbaren Grimasse verzogen hatte. Die Hände, wie Krallen gebogen, hatte er auf mich gerichtet. „Ich bin ein großes, furchtbares Monster und ich werde dich fressen!“ Natürlich wusste ich damals, dass Edward mir niemals etwas antun würde. Trotzdem unterdrückte ich ein Kichern und raffte meine Röcke, um mit einem theatralischen Aufschrei vor ihm Reißaus zu nehmen. Es war ein Spiel. Wir haben es oft gespielt. Er das Monster – Ich die zu Tode verängstigte holde Jungfer. Doch das hier war kein Spiel. Edward blickte mich an mit dem Blick eines Killers. Ich hatte diesen Blick schon das ein oder andere Mal gesehen. Er war bereit mich zu töten, wenn ich auch nur einen einzigen falschen Schritt machte. War es das, wovor mein Unterbewusstsein versucht hatte mich zu warnen? Ich hätte nicht herkommen sollen. Ich hätte umdrehen sollen, als ich noch die Gelegenheit dazu gehabt hatte. Doch jetzt war es zu spät.
Jetzt stand ich sieben Vampiren gegenüber, die mich mit ihren Blicken taxierten, bereit zum Sprung. Doch die anderen waren mir relativ egal. Ich konnte nur Edward ansehen. Mein Cousin, der einst geschworen hatte mich zu beschützen. Mein Cousin, der nun den Anschein machte, mir jeden Moment den Kopf abreißen zu wollen, um ihn zu verbrennen. Er hatte mich vergessen. Wie so viele Vampire hatte er alles vergessen, was mit seinem Leben zu tun gehabt hatte. Und der kleine Funke Hoffnung, der sich bis zum Schluss in mir am Leben gehalten hatte, erlosch mit einem leisen Zischen. Tränen rollten über meine Wangen, als ich die Augen schloss und mich mit dem abfand, was nun kommen mochte. Sollten sie mir doch ein für alle Mal den Garaus machen. Mir war es egal. Ich hatte alles verloren. Ich war allein. Ich wollte nicht mehr existieren.
Ich kniff meine Lider fest zusammen und ignorierte alles um mich herum. Ich achtete weder auf die Atemgeräusche oder den Herzschlag des Mädchens, noch auf die leisen Geräusche der scharrenden Füße auf dem Holzfußboden. Ich gab mich einzig und allein den Erinnerungen hin. Den Erinnerungen an schöne Zeiten, als Edward mir noch im Spaß damit drohte mich zu meucheln, mir aber in Wirklichkeit niemals auch nur ein Haar gekrümmt hätte. Ich erinnerte mich daran, wie wir gemeinsam durch den Garten gerannt waren und Fußball gespielt hatten, was meine Tante als überaus unschicklich empfunden hatte. Ich erinnerte mich an die Momente stiller Eintracht, in denen ich mit einem Buch im Salon gesessen hatte und seinem Klavierspiel lauschte. Und während ich mich erinnerte, wartete ich darauf, dass sie endlich zum Angriff übergingen. Das sie meine leidige Existenz endlich vernichteten, damit ich Frieden finden konnte.
„Hör auf damit! Was soll das? Wer bist du?“, brüllte plötzlich jemand, gefolgt von einem weiteren bösen Knurren und ich schlug erschrocken die Augen auf, wobei die Tränen, die sich in meinen Wimpern gesammelt hatten, zu Boden fielen.
„Weint sie?“, fragte eine der Frauen. Voller Verwunderung legte sie den Kopf schief und musterte mich von oben bis unten.
Ich ignorierte ihre Frage und räusperte mich leise. Dann versuchte ich das Wort an Edward zu richten. „Womit soll ich aufhören?“ Meine Stimme klang dünn und brüchig, wie jedes Mal, wenn ich weinen musste.
„Na, mit diesem wirren Gedankenkram!“ Zornig schrie er mich an, wobei er seinen Griff um das Mädchen noch verstärkte. Ihre Haut unter seiner Hand verfärbte sich verdächtig blau, doch sie gab nicht einen Mucks von sich. Meinem Blick wich er dabei aus, als könne er es aus irgendeinem Grund nicht ertragen mich anzusehen. Konnte er sich vielleicht doch an mich erinnern? Irgendwo tief in seinem Unterbewusstsein? Aber woher wusste er, woran ich gedacht hatte? Verwirrung nahm mich für einen kurzen Moment komplett ein, dann ging mir langsam ein Licht auf. Ich wusste, dass manche Vampire bestimmte Fähigkeiten hatten. Ich kannte eine Frau in Frankreich, die sich vorzüglich darauf verstand, den Willen anderer zu manipulieren. Ich wusste von den Volturi und den Fähigkeiten ihrer Anhänger, die zum größten Teil sehr mächtig waren. Ja, ich selbst hatte eine gewisse Fähigkeit, die mir allerdings noch nie einen Vorteil verschafft hatte. War es möglich, dass Edwards Fähigkeit darin bestand, dass er in die Köpfe anderer Leute sehen konnte und dadurch wusste was sie dachten?
„Du… du… k… also ich meine, kannst du Gedanken lesen?“ Obwohl sich die Situation um mich herum langsam ein wenig entspannte, zitterte meine Stimme immer noch heftig.
Ich bekam keine Antwort von ihm und auch auf den Gesichtern der anderen Anwesenden konnte ich keinen Hinweis darauf finden, ob ich Recht hatte oder nicht. Aber wieso hätte er mich sonst dazu auffordern sollen, mit meinem „Gedankenkram“ aufzuhören? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich recht hatte und witterte darin meine Chance. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich viel zu verlieren. Ich ging ohnehin davon aus, dass man dachte, ich hätte es auf das Mädchen abgesehen und so besitzergreifend, wie Edward sie festhielt, würde er mich töten, wenn ich auch nur einen falschen Schritt machte. Und mit dem Tod konnte ich sehr gut leben. Er konnte mich jedoch nicht daran hindern, zu denken was ich wollte und damit seinem Erinnerungsvermögen vielleicht ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Wieder schloss ich die Augen. Konzentrierte mich auf meine Gedanken und begann, sie zu sortieren. Dann erinnerte ich mich an jenen Abend, an dem meine Mutter mich verlassen hatte. Jener Abend, an dem Edward mir geschworen hatte, von nun an auf mich aufzupassen. Ich ließ unsere ganze gemeinsame Vergangenheit im Kopf Revue passieren und hatte scheinbar Erfolg. „Lasst sie los“, hörte ich Edward wie aus weiter Ferne sagen und tatsächlich lösten sich die Griffe, die meine Arme gefangen gehalten hatten. Um mich herum herrschte völlige Stille, aber ich konnte die Blicke spüren, die zwischen mir und meinem Cousin hin und her wanderten. Als ich die Augen wieder öffnete, hatte Edward das Mädchen losgelassen und ein paar Schritte auf mich zu gemacht. Er stand mir jetzt genau gegenüber. Ich hätte nur den Arm ausstrecken müssen, dann hätte ich ihn berühren können. Und ein nicht gerade kleiner Teil von mir gierte danach, ihn anzufassen. Es verlangte mich nach der Gewissheit, dass es ihn tatsächlich gab. Aber ich riss mich zusammen. Jede falsche Bewegung hätte die Situation zur Eskalation treiben können.
„Weißt du, wer ich bin?“, fragte ich mit leiser, aber nun wieder fester Stimme.
Ein leichter Ruck ging durch den ewig jungen Körper meines Cousins. Eine Mischung aus Nicken, Kopfschütteln und Schulterzucken zugleich. Es sah merkwürdig aus, aber trotzdem bildete ich mir ein, diese Geste zu verstehen. Ich ließ ihm Zeit, in seinem Gehirn Nachforschungen anzustellen und beschränkte mich darauf, ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Er sah tatsächlich immer noch genauso aus wie der siebzehnjährige Junge, den ich 1918 das letzte Mal gesehen hatte. Allerdings wirkte er dieses Mal bei Weitem nicht so müde und abgeschlagen wie damals. Auch wenn seine Haut so weiß war wie Schnee, wirkte sie nicht kränklich. Er strahlte Stärke und Selbstbewusstsein aus. Doch genau wie den meisten Vampiren, denen ich bisher begegnet war, umgab auch ihn eine gewisse Aura der Hoffnungslosigkeit. Sein Körper war in teure Designerkleidung gehüllt, die ihm das Aussehen eines weltgewandten Beaus verlieh. Wahrscheinlich lagen ihm die Mädchen gleich scharenweise zu Füßen. Oder eben auch nicht, weil er ihnen Angst machte. Ebenso sahen alle anderen anwesenden Vampire unglaublich gut und unglaublich teuer gekleidet aus. Aber auch ebenso unglaublich gefährlich.
„Ähm ...“ Nervös fuhr er sich mit seinen langen, filigranen Fingern durch die dichten Haare. „Ist dein Name Anna?“
Es fühlte sich an, als machte mein totes Herz einen kleinen Sprung, auch wenn mein Name nicht wirklich Anna war. „Joanna“, korrigierte ich ihn, ohne einen Vorwurf in der Stimme. „Anni.“
Er nickte zustimmend, der Blick konzentriert auf mich gerichtet. Mit einem weiteren kleinen Schritt überbrückte er auch den letzten Abstand zwischen uns. Ich konnte spüren, dass er regelmäßig ein- und ausatmete. Eine Gewohnheit, die sich irgendwann einschleicht, wenn man viel Zeit mit Menschen verbrachte. Auch ich sog tief und regelmäßig die Luft in meine Lungen, hörte dann allerdings auf zu atmen, als er die Hand hob und eine verirrte Haarsträhne hinter mein Ohr zurückschob. „Deine Augen. Sie … sie waren früher blau, oder?“ Ich nickte ganz sachte, denn ich wollte es vermeiden mich zu bewegen, aus Angst diesen magischen Moment zu zerstören. „Du bist meine Cousine, nicht wahr? Wir sind zusammen aufgewachsen. Du … du hast immer so viel gelesen, deshalb hab ich dich Bücherwurm genannt.“ Er erinnerte sich an mich.
Ich nickte wieder, dieses Mal allerdings heftiger. Freudentränen sammelten sich in meinen Augen, während ich in meinem Kopf weitere Erinnerungen heraufbeschwor. Erinnerungen daran, wie er heimlich die Lesezeichen aus meinen Büchern geklaut hatte, genauso wie Erinnerungen an Regentage, an denen wir uns gegenseitig in die größten Pfützen geschubst hatten und anschließend mächtig Ärger bezogen hatten, erst von meiner Tante und dann von Sidonie. Ich schreckte heftig zusammen, als er ganz plötzlich auch die andere Hand hob und mich in seine Arme zog. Seinen Körper an meinen presste, in der schieren Verzweiflung, ich könnte nur eine Einbildung sein. Dieselbe Verzweiflung, die auch ich empfand. Ich erwiderte seine Umarmung mit aller Kraft, die ich zur Verfügung hatte. „Anni“, flüsterte er leise meinen Namen in mein Haar. „Edward.“ Meine Tränen versickerten im Stoff seines Hemdes. Ich hatte in den letzten Wochen so viel geweint, dass ich es schon fast als Alltäglichkeit empfand. Doch dieses Mal weinte ich nicht aus Kummer, aus Angst oder Schmerz, ich weinte aus Freude. Ich war nicht mehr allein. Ich hatte Edward wiedergefunden. Ein Gefühl der vollkommenen Erleichterung ließ mich schwerelos werden. Vergessen waren die anderen Vampire und das Mädchen, die uns beobachteten. All das war in diesem Moment nicht wichtig. Diese Dinge konnten wir immer noch später klären. Jetzt zählte nur Edward, an den ich mich klammerte, wie an einen rettenden Halm, der mich vor dem Ertrinken bewahrte.
Vielleicht umarmten wir uns nur für ein paar Sekunden oder Minuten, aber es hätten genauso gut Stunden gewesen sein können. Scheinbar traute sich keiner von uns den anderen loszulassen, aus Angst, dieser könnte dann ganz plötzlich und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Edward schaffte es dann aber schließlich doch, seinen Griff ein wenig zu lockern und sich zu der wartenden und vor allen Dingen äußerst neugierig wirkenden Menge zu drehen. Meine Hand ließ er allerdings nicht los und ich war froh über diese spürbare Verbindung zu ihm. „Leute“, richtete er feierlich das Wort an sie und ein breites Lächeln war wie auf sein schönes Gesicht gestempelt. „Das ist meine Cousine Anni. Anni – das ist meine ‚Familie`. Das sind Emmet, Rose, Jasper, Alice, Esme und Carlisle. Und das ist meine Freundin Bella.“
Ich ließ meinen Blick von einem zum Anderen schweifen und versuchte mir die Namen genau einzuprägen. Als ich bei dem Mädchen angekommen war, wanderte mein Blick eine Person zurück und ich taxierte den Mann, der beinahe die Würde eines Königs ausstrahlte. „Ich kenne Sie.“
Jetzt stand ich sieben Vampiren gegenüber, die mich mit ihren Blicken taxierten, bereit zum Sprung. Doch die anderen waren mir relativ egal. Ich konnte nur Edward ansehen. Mein Cousin, der einst geschworen hatte mich zu beschützen. Mein Cousin, der nun den Anschein machte, mir jeden Moment den Kopf abreißen zu wollen, um ihn zu verbrennen. Er hatte mich vergessen. Wie so viele Vampire hatte er alles vergessen, was mit seinem Leben zu tun gehabt hatte. Und der kleine Funke Hoffnung, der sich bis zum Schluss in mir am Leben gehalten hatte, erlosch mit einem leisen Zischen. Tränen rollten über meine Wangen, als ich die Augen schloss und mich mit dem abfand, was nun kommen mochte. Sollten sie mir doch ein für alle Mal den Garaus machen. Mir war es egal. Ich hatte alles verloren. Ich war allein. Ich wollte nicht mehr existieren.
Ich kniff meine Lider fest zusammen und ignorierte alles um mich herum. Ich achtete weder auf die Atemgeräusche oder den Herzschlag des Mädchens, noch auf die leisen Geräusche der scharrenden Füße auf dem Holzfußboden. Ich gab mich einzig und allein den Erinnerungen hin. Den Erinnerungen an schöne Zeiten, als Edward mir noch im Spaß damit drohte mich zu meucheln, mir aber in Wirklichkeit niemals auch nur ein Haar gekrümmt hätte. Ich erinnerte mich daran, wie wir gemeinsam durch den Garten gerannt waren und Fußball gespielt hatten, was meine Tante als überaus unschicklich empfunden hatte. Ich erinnerte mich an die Momente stiller Eintracht, in denen ich mit einem Buch im Salon gesessen hatte und seinem Klavierspiel lauschte. Und während ich mich erinnerte, wartete ich darauf, dass sie endlich zum Angriff übergingen. Das sie meine leidige Existenz endlich vernichteten, damit ich Frieden finden konnte.
„Hör auf damit! Was soll das? Wer bist du?“, brüllte plötzlich jemand, gefolgt von einem weiteren bösen Knurren und ich schlug erschrocken die Augen auf, wobei die Tränen, die sich in meinen Wimpern gesammelt hatten, zu Boden fielen.
„Weint sie?“, fragte eine der Frauen. Voller Verwunderung legte sie den Kopf schief und musterte mich von oben bis unten.
Ich ignorierte ihre Frage und räusperte mich leise. Dann versuchte ich das Wort an Edward zu richten. „Womit soll ich aufhören?“ Meine Stimme klang dünn und brüchig, wie jedes Mal, wenn ich weinen musste.
„Na, mit diesem wirren Gedankenkram!“ Zornig schrie er mich an, wobei er seinen Griff um das Mädchen noch verstärkte. Ihre Haut unter seiner Hand verfärbte sich verdächtig blau, doch sie gab nicht einen Mucks von sich. Meinem Blick wich er dabei aus, als könne er es aus irgendeinem Grund nicht ertragen mich anzusehen. Konnte er sich vielleicht doch an mich erinnern? Irgendwo tief in seinem Unterbewusstsein? Aber woher wusste er, woran ich gedacht hatte? Verwirrung nahm mich für einen kurzen Moment komplett ein, dann ging mir langsam ein Licht auf. Ich wusste, dass manche Vampire bestimmte Fähigkeiten hatten. Ich kannte eine Frau in Frankreich, die sich vorzüglich darauf verstand, den Willen anderer zu manipulieren. Ich wusste von den Volturi und den Fähigkeiten ihrer Anhänger, die zum größten Teil sehr mächtig waren. Ja, ich selbst hatte eine gewisse Fähigkeit, die mir allerdings noch nie einen Vorteil verschafft hatte. War es möglich, dass Edwards Fähigkeit darin bestand, dass er in die Köpfe anderer Leute sehen konnte und dadurch wusste was sie dachten?
„Du… du… k… also ich meine, kannst du Gedanken lesen?“ Obwohl sich die Situation um mich herum langsam ein wenig entspannte, zitterte meine Stimme immer noch heftig.
Ich bekam keine Antwort von ihm und auch auf den Gesichtern der anderen Anwesenden konnte ich keinen Hinweis darauf finden, ob ich Recht hatte oder nicht. Aber wieso hätte er mich sonst dazu auffordern sollen, mit meinem „Gedankenkram“ aufzuhören? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich recht hatte und witterte darin meine Chance. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich viel zu verlieren. Ich ging ohnehin davon aus, dass man dachte, ich hätte es auf das Mädchen abgesehen und so besitzergreifend, wie Edward sie festhielt, würde er mich töten, wenn ich auch nur einen falschen Schritt machte. Und mit dem Tod konnte ich sehr gut leben. Er konnte mich jedoch nicht daran hindern, zu denken was ich wollte und damit seinem Erinnerungsvermögen vielleicht ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Wieder schloss ich die Augen. Konzentrierte mich auf meine Gedanken und begann, sie zu sortieren. Dann erinnerte ich mich an jenen Abend, an dem meine Mutter mich verlassen hatte. Jener Abend, an dem Edward mir geschworen hatte, von nun an auf mich aufzupassen. Ich ließ unsere ganze gemeinsame Vergangenheit im Kopf Revue passieren und hatte scheinbar Erfolg. „Lasst sie los“, hörte ich Edward wie aus weiter Ferne sagen und tatsächlich lösten sich die Griffe, die meine Arme gefangen gehalten hatten. Um mich herum herrschte völlige Stille, aber ich konnte die Blicke spüren, die zwischen mir und meinem Cousin hin und her wanderten. Als ich die Augen wieder öffnete, hatte Edward das Mädchen losgelassen und ein paar Schritte auf mich zu gemacht. Er stand mir jetzt genau gegenüber. Ich hätte nur den Arm ausstrecken müssen, dann hätte ich ihn berühren können. Und ein nicht gerade kleiner Teil von mir gierte danach, ihn anzufassen. Es verlangte mich nach der Gewissheit, dass es ihn tatsächlich gab. Aber ich riss mich zusammen. Jede falsche Bewegung hätte die Situation zur Eskalation treiben können.
„Weißt du, wer ich bin?“, fragte ich mit leiser, aber nun wieder fester Stimme.
Ein leichter Ruck ging durch den ewig jungen Körper meines Cousins. Eine Mischung aus Nicken, Kopfschütteln und Schulterzucken zugleich. Es sah merkwürdig aus, aber trotzdem bildete ich mir ein, diese Geste zu verstehen. Ich ließ ihm Zeit, in seinem Gehirn Nachforschungen anzustellen und beschränkte mich darauf, ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Er sah tatsächlich immer noch genauso aus wie der siebzehnjährige Junge, den ich 1918 das letzte Mal gesehen hatte. Allerdings wirkte er dieses Mal bei Weitem nicht so müde und abgeschlagen wie damals. Auch wenn seine Haut so weiß war wie Schnee, wirkte sie nicht kränklich. Er strahlte Stärke und Selbstbewusstsein aus. Doch genau wie den meisten Vampiren, denen ich bisher begegnet war, umgab auch ihn eine gewisse Aura der Hoffnungslosigkeit. Sein Körper war in teure Designerkleidung gehüllt, die ihm das Aussehen eines weltgewandten Beaus verlieh. Wahrscheinlich lagen ihm die Mädchen gleich scharenweise zu Füßen. Oder eben auch nicht, weil er ihnen Angst machte. Ebenso sahen alle anderen anwesenden Vampire unglaublich gut und unglaublich teuer gekleidet aus. Aber auch ebenso unglaublich gefährlich.
„Ähm ...“ Nervös fuhr er sich mit seinen langen, filigranen Fingern durch die dichten Haare. „Ist dein Name Anna?“
Es fühlte sich an, als machte mein totes Herz einen kleinen Sprung, auch wenn mein Name nicht wirklich Anna war. „Joanna“, korrigierte ich ihn, ohne einen Vorwurf in der Stimme. „Anni.“
Er nickte zustimmend, der Blick konzentriert auf mich gerichtet. Mit einem weiteren kleinen Schritt überbrückte er auch den letzten Abstand zwischen uns. Ich konnte spüren, dass er regelmäßig ein- und ausatmete. Eine Gewohnheit, die sich irgendwann einschleicht, wenn man viel Zeit mit Menschen verbrachte. Auch ich sog tief und regelmäßig die Luft in meine Lungen, hörte dann allerdings auf zu atmen, als er die Hand hob und eine verirrte Haarsträhne hinter mein Ohr zurückschob. „Deine Augen. Sie … sie waren früher blau, oder?“ Ich nickte ganz sachte, denn ich wollte es vermeiden mich zu bewegen, aus Angst diesen magischen Moment zu zerstören. „Du bist meine Cousine, nicht wahr? Wir sind zusammen aufgewachsen. Du … du hast immer so viel gelesen, deshalb hab ich dich Bücherwurm genannt.“ Er erinnerte sich an mich.
Ich nickte wieder, dieses Mal allerdings heftiger. Freudentränen sammelten sich in meinen Augen, während ich in meinem Kopf weitere Erinnerungen heraufbeschwor. Erinnerungen daran, wie er heimlich die Lesezeichen aus meinen Büchern geklaut hatte, genauso wie Erinnerungen an Regentage, an denen wir uns gegenseitig in die größten Pfützen geschubst hatten und anschließend mächtig Ärger bezogen hatten, erst von meiner Tante und dann von Sidonie. Ich schreckte heftig zusammen, als er ganz plötzlich auch die andere Hand hob und mich in seine Arme zog. Seinen Körper an meinen presste, in der schieren Verzweiflung, ich könnte nur eine Einbildung sein. Dieselbe Verzweiflung, die auch ich empfand. Ich erwiderte seine Umarmung mit aller Kraft, die ich zur Verfügung hatte. „Anni“, flüsterte er leise meinen Namen in mein Haar. „Edward.“ Meine Tränen versickerten im Stoff seines Hemdes. Ich hatte in den letzten Wochen so viel geweint, dass ich es schon fast als Alltäglichkeit empfand. Doch dieses Mal weinte ich nicht aus Kummer, aus Angst oder Schmerz, ich weinte aus Freude. Ich war nicht mehr allein. Ich hatte Edward wiedergefunden. Ein Gefühl der vollkommenen Erleichterung ließ mich schwerelos werden. Vergessen waren die anderen Vampire und das Mädchen, die uns beobachteten. All das war in diesem Moment nicht wichtig. Diese Dinge konnten wir immer noch später klären. Jetzt zählte nur Edward, an den ich mich klammerte, wie an einen rettenden Halm, der mich vor dem Ertrinken bewahrte.
Vielleicht umarmten wir uns nur für ein paar Sekunden oder Minuten, aber es hätten genauso gut Stunden gewesen sein können. Scheinbar traute sich keiner von uns den anderen loszulassen, aus Angst, dieser könnte dann ganz plötzlich und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Edward schaffte es dann aber schließlich doch, seinen Griff ein wenig zu lockern und sich zu der wartenden und vor allen Dingen äußerst neugierig wirkenden Menge zu drehen. Meine Hand ließ er allerdings nicht los und ich war froh über diese spürbare Verbindung zu ihm. „Leute“, richtete er feierlich das Wort an sie und ein breites Lächeln war wie auf sein schönes Gesicht gestempelt. „Das ist meine Cousine Anni. Anni – das ist meine ‚Familie`. Das sind Emmet, Rose, Jasper, Alice, Esme und Carlisle. Und das ist meine Freundin Bella.“
Ich ließ meinen Blick von einem zum Anderen schweifen und versuchte mir die Namen genau einzuprägen. Als ich bei dem Mädchen angekommen war, wanderte mein Blick eine Person zurück und ich taxierte den Mann, der beinahe die Würde eines Königs ausstrahlte. „Ich kenne Sie.“
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 11 Part 1
@all Ich war wirklich sehr überrascht über die Resonanz, die das Letzte Kapitel ausgelöst hat. Zehn neue Favoriteneinträge, darauf bilde ich mir jetzt echt mal was ein. Immerhin scheinen zumindest 15 Leute diese Geschichte für so gut zu befinden, um sie weiter zu verfo9lgen. Trotz der großen Resonanz ist es mir allerdings wieder nicht gelungen euch zügig mit einem neuen Update zu versorgen. Das tut mir unendlich leid. Ich bemühe mich immer redlich, aber ich habe momentan soviele persönliche Verpflichtungen, um nicht zu sagen Freizeitstress, dass ich es nicht auf die Kette kriege. Ich bin keine Wahnsinnsautorin, aber auch ich habe gewissen Ansprüche an mich und meine Geschichten und die kann ich einfach nicht einhalten, wenn ich ein neues Kapitel einfach so dahinfuddel. Ich kann allerdings auch jeden verstehen, der sagt, dass es ihm/ihr hier zu langsam voran geht und er/sie diese Geschichte lieber nicht mehr lesen mag. Die langen Wartezeiten sind mir unangenehmen, aber momentan nötig, um die Qualität (so denn welche vorhanden ist) dieser Geschichte zu halten. Ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen. Auch für das nächste Kapitel kann ich nur wieder sagen, ich werde mich bemühen, aber ich bin ein verdammt fehlbarer Mensch. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Kapitel gefällt und wünsche euch ganz viel Spaß beim lesen.
LG
Blossom
~*~*~*~*~*~*~*~*
Mehr aus Gewohnheit als aus gegebener Notwendigkeit, kniff ich die Augen ein wenig zusammen, um mein Gegenüber besser mustern zu können. Ich hatte dieses Gesicht definitiv schon einmal gesehen. Da war ich mir ganz sicher. Aber wo und wann, das konnte ich nicht sagen. Der Vampir, den Edward mir als Carlisle vorgestellt hatte, räusperte sich unwohl ob meiner genauen Musterung. Ich rang mir ein verkniffenes Lächeln ab. „Ich könnte schwören, Sie schon einmal irgendwo gesehen zu haben, aber ich weiß nicht, wo und wann“, gestand ich, da scheinbar jeder auf eine Erklärung zu warten schien.
„Ich hingegen kann mich noch sehr genau an Sie erinnern.“ Verblüfft riss ich die Augenbrauen hoch, gierig nach einer Antwort, die er mir allerdings nicht geben wollte. Doch ich war nicht die Einzige, die ihre Emotionen zu diesem Thema offen auf dem Gesicht trug. Edwards Miene war ebenfalls ein Wechselspiel aus Überraschung, Schock und etwas, dass ich als Wut einordnete. „Es ist nicht das, was du denkst. Und du solltest mich viel zu gut kennen, um so etwas überhaupt zu denken.“ Scheinbar hatte auch Carlisle den missmutigen Blick meines Cousins aufgefangen und ein schmales Lächeln kräuselte sich in seinen Mundwinkeln. „Vielleicht sollten wir uns erst einmal hinsetzen und ein wenig zur Ruhe kommen.“ Mit der rechten Hand deutete Carlisle auf die Sitzmöbel. Ein kurzer Ruck ging durch die gesammelte Menge, dann setzte sich einer nach dem Anderen in Bewegung, um sich schließlich einen Sitzplatz auf dem Sofa, einem der Sessel oder wahlweise auf dem Fußboden zu suchen. Relativ schnell war klar, dass hier jeder seinen festen Platz hatte, wie es in einer normalen Familie üblich war. Jeder, außer mir. Etwas unsicher blieb ich deshalb mitten im Raum stehen, bis jeder saß und ließ mich erst dann in dem Sessel nieder, den Edward mir zuwies.
Obwohl sich die Spannung merklich gelegt hatte, war eine allgemeine Beklommenheit überdeutlich zu spüren. Die irritierend schöne Frau, die mir Edward als Rosalie vorgestellt hatte bleckte immer noch kampflustig die Zähne, um mir zu demonstrieren, dass sie mir nicht mehr als ich ihr über den Weg traute. Ich beschloss, sie zu ignorieren. Sie und alle anderen Anwesenden. Alle außer Edward, dem ich mich zugewandt hatte. Am liebsten hätte ich wieder nach seiner Hand gefasst, um ihn festzuhalten. Nur um sicher zu gehen, dass er wirklich da war. Und vielleicht auch ein wenig, um meine Nerven zu beruhigen. Wenn ich früher aufgeregt war, hatte Collin immer meine Hand gefasst und sie dann gedrückt, um mir zu zeigen, dass ich nicht alleine war. Doch jetzt war ich alleine. Alleine unter Fremden, denn auch Edward war mir keineswegs mehr so vertraut wie früher. Er war genauso ein Fremder wie all die anderen Vampire. Ich wusste nichts von seinem Leben als Vampir. Ich wusste nicht, was in seinem „Leben“ geschehen war, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Jenem schrecklichen Tag, als er mir verbot ihn in die Arme zu schließen und zu trösten. Jenem Tag, an dem er mich einfach für immer verließ.
„Willst du darüber sprechen?“ Abrupt riss ich den Kopf hoch und sah Edward verwundert an. „Ich meine das, worüber du gerade nachgedacht hast“, beantwortete er meine nichtgestellte Frage. Würde in meinen Adern noch Blut fließen, so wäre ich wahrscheinlich rot geworden. Er konnte hören, sehen oder wie auch immer, was sich in meinem Kopf abspielte. Ein irgendwie beklemmendes Gefühl. „Es tut mir leid, ich wollte nicht deine Gedanken ausspionieren, aber sie sind noch so neu und deutlich für mich. Außerdem würde ich gerne mehr über damals erfahren und über dich. Meine Erinnerungen sind sehr lückenhaft. Vielleicht könntest du mir helfen, diese Lücken zu füllen. Vor allem aber will ich alles über dich wissen. Was geschehen ist nach dem ich…“, er stockte kurz, als müsste er tief durchatmen um weitersprechen zu können. „… nach dem ich weg war. Wie bist du zu einem Vampir geworden und was hast du bis heute gemacht und alles einfach.“
„Das Gleiche könnte ich dich fragen. Aber da ich wohl diejenige bin, die hier einfach ungebeten aufgekreuzt ist, sollte ich wohl den Anfang machen.“ Es war nun fast vollkommen still in dem luxuriös eingerichteten Wohnzimmer. Einzig und allein die Atmung und der Herzschlag von Bella waren klar und deutlich zu vernehmen, sowie die Geräusche, die sie verursachte, wenn sie sich bewegte. Und das musste sie schließlich, im Gegensatz zu mir oder den anderen. Aber eigentlich war mir das relativ egal. Sie war mir egal. Für mich war jetzt nur Edward wichtig und ich fragte mich, ob ich all seine Fragen in Gedanken beantworten sollte, damit sie nur für ihn bestimmt waren oder ob ich meine Geschichte laut und für alle erzählen sollte.
„Ich denke, du solltest sie laut erzählen.“ Wieder antwortete Edward auf meine Gedanken und wieder traf es mich völlig überraschend. Welch seltsam irritierende Fähigkeit. Die Personen in seinem Umfeld hatten dadurch ja quasi gar keine Privatsphäre mehr. Und an dem gequälten Lächeln, das er mir zuwarf, konnte ich erraten, dass er sich diesem Umstand bewusst war und es ihm irgendwie auch Leid tat. Aber er konnte ja nun einmal nichts für seine Gabe.
Leise seufzend lehnte ich mich in dem Sessel zurück und erinnerte mich.
*Rückblick*
Mit offenen Augen lag ich in meinem Bett und starrte an die Decke. Tom lag neben mir und gab leise, schnaufende Atemgeräusche von sich. Er war gerade erst wieder eingeschlafen und würde mir nun ein paar Stunden Ruhe lassen, bevor er wieder nach seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Essen, verlangte. Und obwohl ich unendlich müde war und die paar Stunden Schlaf, die mein Sohn mir gönnte, dringend benötigt hätte, konnte ich die Augen einfach nicht zumachen. Mein Puls war leicht beschleunigt. Unter meinen gefalteten Händen hob und senkte sich meine Brust viel zu schnell um einzuschlafen. Ich war hochgradig beunruhigt. Edward hatte sehr schlecht ausgesehen, als er noch während des Abendessens das Haus verlassen hatte, um an das Krankenbett seiner Mutter zu eilen. Mich ließ das beklemmende Gefühl nicht los, dass Edward der nächste von uns sein würde, der erkrankte. Er war müde und ausgezerrt. Seit Tagen hatte er kaum richtig gegessen oder geschlafen und verbrachte Tag und Nacht in einem Krankenhaus voller Sterbender. Er wäre ein leichtes Opfer für die spanische Grippe gewesen. Wir hatten von Fällen gehört, da hatte es keine 24 Stunden gedauert, bis der Tod sein Opfer verschlungen hatte.
Ganz langsam breitete sich eine unangenehme Gänsehaut auf meinem Körper aus, sodass sich die feinen Härchen auf meinen Armen aufrichteten. Schnell zog ich mir die Decke bis ans Kinn, doch es änderte nichts an dem merklichen Frösteln. Erst Thomas, dann mein Onkel und nun meine Tante. Sollte Edward also als Nächster für meine Schuld büßen? Geräuschvoll zog ich die Nase hoch und drehte mich auf die Seite, um meinen Sohn im faden Mondschein zu betrachten. Sicherlich. Er war jedes Opfer wert, doch sollte nicht ich es sein, die für ihre Sünden zahlt und nicht die Anderen? Die Welt oder zumindest meine eigene Welt hatte sich in den letzten Wochen und Monaten so sehr verändert, dass ich es immer noch nicht geschafft hatte einen Platz darin zu finden und so langsam war ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob es wirklich für jeden Menschen einen Platz im Leben gab.
Zärtlich legte ich meine rechte Hand auf Toms Brust und spürte den gleichmäßigen, kräftigen Herzschlag. „Mein Platz ist da wo du bist. Ich liebe dich.“, flüsterte ich in die Dunkelheit und meinte damit gleichermaßen meinen Sohn, als auch meinen Mann. Doch ich liebe auch Edward, ebenso wie meine Tante oder Mary. Seit Monaten hatte ich nicht mehr gebetet. Nun erschien es mir, als sei der richtige Zeitpunkt gekommen, einen letzten Versuch zu unternehmen, mit Gott zu reden. Ich drehte mich zurück auf den Rücken und faltete die Hände. Meine Augen brannten bereits vor Müdigkeit, weshalb ich sie schloss. Ein fataler Fehler. Noch während ich überlegte, wie ich mein Gespräch mit dem Allmächtigen beginnen sollte, glitt ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf, ohne das ich mich dagegen hätte wehren können. Vielleicht hätte dieses Gebet ja irgendetwas an dem geändert, was in dieser Nacht geschah.
Ein seltsames Geräusch riss mich am frühen Morgen aus meinem komaartigen Zustand. Zuerst hatte ich gedacht es wäre Tom, der mal wieder vor seiner Zeit Appetit bekommen hatte, doch der Säugling lag wie ein warmer Stein neben mir. Die geballten Fäuste hatte er vor sich in die Luft gestreckt und sein schönes Gesicht war zu einer verkniffenen Grimasse verzogen, doch er schien zu schlafen. Ein Traum vielleicht. Auch das vermeintliche Geräusch, das mich geweckt hatte, war nun nicht mehr zu hören. Eine Einbildung? Kraftlos rieb ich mir mit dem Handrücken über meine müden Augen, bevor ich mich vorsichtig aufrichtete. Die Sonne ging bereits langsam auf und verfärbte die Welt vor meinem Fenster silbrig. Bald würde Tom so oder so aufwachen und Sidonie würde auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es lohnte sich also gar nicht mehr, sich noch einmal hinzulegen.
Gerade als meine nackten Füße den kalten Fußboden berührten, hörte ich es wieder. Eine Art Wummern. Verwundert drehte ich den Kopf in alle Richtungen. Ich war noch viel zu verschlafen, um es richtig zu orten. Doch dann wurde es lauter. Das Wummern schwoll zu einem Klopfen unten an der Haustür an. Wer klopfte denn um diese unchristliche Zeit? Erstaunt legte ich die Stirn in Falten, drückte mich aber vom Bett hoch, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Zuvor legte ich meinen Sohn allerdings noch schnell in sein eigenes Bettchen und warf mir meinen Morgenmantel über das spitzenverzierte Nachthemd. Da der Flur nur ein paar winzige Fenster besaß, war es hier noch fast vollständig dunkel, als ich die Tür öffnete und hinaustrat. Jemand klopfte tatsächlich an unsere Haustür. Es war keine Einbildung gewesen. Ganz im Gegenteil. Jemand schlug mit beiden Fäusten, in schierer Verzweiflung gegen das schwere Holz. „ANNI? MARY?“, brüllte eine Frauenstimme und wieder wurde kräftig gegen das Holz geschlagen. „ANNI?“ Erschrocken schloss ich schnell den Gürtel meines Mantels und hastete die Treppe hinab in die Empfangshalle.
Überstürzt riss ich mit viel zu viel Kraft die Haustür auf, sodass ich fast gestolpert und nach hinten gefallen wäre. Doch ich schaffte es noch in allerletzter Sekunde mein Gleichgewicht wiederzufinden und mich so vor dem Sturz zu bewahren. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich Georgia an, die nun vor mir stand. Sie trug ein schlichtes graues Leinenkleid mit einer weißen Schürze, wie sie alle Schwesternschülerinnen im Hospital trugen. Ihr blondes Haar hatte sie hochgesteckt, doch einige Strähnen hatten sich gelöst und blickten wirr unter ihrer Haube hervor. Wie die meisten Leute, wirkte auch sie in diesen Tagen mager und abgeschlagen. Ihre blauen Augen lagen tief in den Höhlen, die von schwarzen Ringen gezeichnet wurden. Unendliche Trauer ging von ihr aus.
‚Meine Tante‘, schoss es mir sofort durch den Kopf. Meine Tante war gestorben und Edward hatte Georgia geschickt, um mir diese traurige Botschaft zu überbringen. Mein Herz wurde unglaublich schwer und ich bereute es augenblicklich, auf meinen Cousin gehört zu haben. Ich hatte die letzte Chance verpasst meiner Tante für alles zu danken, was sie für mich getan hatte. Für all die Jahre, die sie mir eine Mutter gewesen war, als meine eigene sich geweigert hatte. Für all die schönen Stunden, die wir miteinander verbracht hatten. Ich hatte es versäumt, mich von ihr zu verabschieden. „Meine Tante?“ Ich brachte die Worte nur zögerlich über die Lippen, doch ich brauchte Gewissheit.
„Ja.“ Regentropfengroße Tränen liefen über Georgias Wangen. Sie zitterte am ganzen Leib, als sie einen Schritt auf mich zu machte und eine Hand auf meine Schulter legte. „Und Edward.“
Die Welt um mich herum blieb stehen, während mich gleichzeitig das pure Chaos erfasste. Immer wieder versuchte ich das Gesicht meiner Freundin zu taxieren, um in ihre Augen zu sehen. Doch ihre Silhouette verschwamm vor meinen Augen. Das konnte nur ein schlechter Scherz sein. Ein sehr böser und sehr makaberer Scherz. Edward war am Vorabend gewiss nicht die Gesundheit auf zwei Beinen gewesen, aber er war doch auch nicht so krank gewesen, dass es ihn innerhalb einer Nacht dahin gerafft hätte. „Du lügst“, flüsterte ich leise und begann in blinder Verzweiflung mit dem Kopf zu schütteln, bis mir schwindelig wurde.
„Nein Anni. Ich wünschte es wäre so.“ Ihre Stimme drang aus so weiter Entfernung an mein Ohr, dass ich nicht geglaubt hätte, dass sie neben mir stand. Allerdings konnte ich ihre Hände spüren. Eine, die mich am Arm festhielt, mit erstaunlich viel Kraft für einen so ausgemergelten Körper und die andere, die mir immer wieder beruhigend über den Rücken strich. „Deine Tante starb noch gestern Nacht. Edward hatte bereits sehr hohes Fieber. Ich wies ihn an sich hinzulegen, musste ihm aber versprechen mich um alles zu kümmern. Ich wollte direkt zu euch kommen, doch dann gab es so viele neue Patienten und ich habe es nicht geschafft. Als ich vorhin noch einmal nach ihm sehen wollte, da war er schon…“ Ihre Stimme erstarb in einer Flut von Tränen. „Ich bin sofort hergekommen“, fügte sie schluchzend hinzu.
„Du lügst“, wiederholte ich ein weiteres Mal und riss mich von ihr los. Tränen trübten meinen Blick, als ich los rannte. Ich rannte einfach hinaus auf die Straße, nur bekleidet mit meinem Nachthemd und dem Morgenmantel. An den Füßen trug ich nichts als meiner Haut, doch bemerkte ich weder die Kälte, noch den Unrat, auf den ich trat. Ich rannte einfach. Meine offenen Haare flogen im Wind hin und her und die wenigen Passanten, die sich um diese Uhrzeit bereits auf der Straße befanden, starrten mich an, doch es war mir egal. Mein Herz pochte mir bis zum Hals und mein Puls raste ob der plötzlichen Anstrengung. Ich ignorierte das Brennen meiner Lungen, obwohl ich das Gefühl hatte ersticken zu müssen. Ich lief und lief und lief. Stehen blieb ich erst, als ich die Pforte des Krankenhauses passiert hatte.
LG
Blossom
~*~*~*~*~*~*~*~*
Mehr aus Gewohnheit als aus gegebener Notwendigkeit, kniff ich die Augen ein wenig zusammen, um mein Gegenüber besser mustern zu können. Ich hatte dieses Gesicht definitiv schon einmal gesehen. Da war ich mir ganz sicher. Aber wo und wann, das konnte ich nicht sagen. Der Vampir, den Edward mir als Carlisle vorgestellt hatte, räusperte sich unwohl ob meiner genauen Musterung. Ich rang mir ein verkniffenes Lächeln ab. „Ich könnte schwören, Sie schon einmal irgendwo gesehen zu haben, aber ich weiß nicht, wo und wann“, gestand ich, da scheinbar jeder auf eine Erklärung zu warten schien.
„Ich hingegen kann mich noch sehr genau an Sie erinnern.“ Verblüfft riss ich die Augenbrauen hoch, gierig nach einer Antwort, die er mir allerdings nicht geben wollte. Doch ich war nicht die Einzige, die ihre Emotionen zu diesem Thema offen auf dem Gesicht trug. Edwards Miene war ebenfalls ein Wechselspiel aus Überraschung, Schock und etwas, dass ich als Wut einordnete. „Es ist nicht das, was du denkst. Und du solltest mich viel zu gut kennen, um so etwas überhaupt zu denken.“ Scheinbar hatte auch Carlisle den missmutigen Blick meines Cousins aufgefangen und ein schmales Lächeln kräuselte sich in seinen Mundwinkeln. „Vielleicht sollten wir uns erst einmal hinsetzen und ein wenig zur Ruhe kommen.“ Mit der rechten Hand deutete Carlisle auf die Sitzmöbel. Ein kurzer Ruck ging durch die gesammelte Menge, dann setzte sich einer nach dem Anderen in Bewegung, um sich schließlich einen Sitzplatz auf dem Sofa, einem der Sessel oder wahlweise auf dem Fußboden zu suchen. Relativ schnell war klar, dass hier jeder seinen festen Platz hatte, wie es in einer normalen Familie üblich war. Jeder, außer mir. Etwas unsicher blieb ich deshalb mitten im Raum stehen, bis jeder saß und ließ mich erst dann in dem Sessel nieder, den Edward mir zuwies.
Obwohl sich die Spannung merklich gelegt hatte, war eine allgemeine Beklommenheit überdeutlich zu spüren. Die irritierend schöne Frau, die mir Edward als Rosalie vorgestellt hatte bleckte immer noch kampflustig die Zähne, um mir zu demonstrieren, dass sie mir nicht mehr als ich ihr über den Weg traute. Ich beschloss, sie zu ignorieren. Sie und alle anderen Anwesenden. Alle außer Edward, dem ich mich zugewandt hatte. Am liebsten hätte ich wieder nach seiner Hand gefasst, um ihn festzuhalten. Nur um sicher zu gehen, dass er wirklich da war. Und vielleicht auch ein wenig, um meine Nerven zu beruhigen. Wenn ich früher aufgeregt war, hatte Collin immer meine Hand gefasst und sie dann gedrückt, um mir zu zeigen, dass ich nicht alleine war. Doch jetzt war ich alleine. Alleine unter Fremden, denn auch Edward war mir keineswegs mehr so vertraut wie früher. Er war genauso ein Fremder wie all die anderen Vampire. Ich wusste nichts von seinem Leben als Vampir. Ich wusste nicht, was in seinem „Leben“ geschehen war, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Jenem schrecklichen Tag, als er mir verbot ihn in die Arme zu schließen und zu trösten. Jenem Tag, an dem er mich einfach für immer verließ.
„Willst du darüber sprechen?“ Abrupt riss ich den Kopf hoch und sah Edward verwundert an. „Ich meine das, worüber du gerade nachgedacht hast“, beantwortete er meine nichtgestellte Frage. Würde in meinen Adern noch Blut fließen, so wäre ich wahrscheinlich rot geworden. Er konnte hören, sehen oder wie auch immer, was sich in meinem Kopf abspielte. Ein irgendwie beklemmendes Gefühl. „Es tut mir leid, ich wollte nicht deine Gedanken ausspionieren, aber sie sind noch so neu und deutlich für mich. Außerdem würde ich gerne mehr über damals erfahren und über dich. Meine Erinnerungen sind sehr lückenhaft. Vielleicht könntest du mir helfen, diese Lücken zu füllen. Vor allem aber will ich alles über dich wissen. Was geschehen ist nach dem ich…“, er stockte kurz, als müsste er tief durchatmen um weitersprechen zu können. „… nach dem ich weg war. Wie bist du zu einem Vampir geworden und was hast du bis heute gemacht und alles einfach.“
„Das Gleiche könnte ich dich fragen. Aber da ich wohl diejenige bin, die hier einfach ungebeten aufgekreuzt ist, sollte ich wohl den Anfang machen.“ Es war nun fast vollkommen still in dem luxuriös eingerichteten Wohnzimmer. Einzig und allein die Atmung und der Herzschlag von Bella waren klar und deutlich zu vernehmen, sowie die Geräusche, die sie verursachte, wenn sie sich bewegte. Und das musste sie schließlich, im Gegensatz zu mir oder den anderen. Aber eigentlich war mir das relativ egal. Sie war mir egal. Für mich war jetzt nur Edward wichtig und ich fragte mich, ob ich all seine Fragen in Gedanken beantworten sollte, damit sie nur für ihn bestimmt waren oder ob ich meine Geschichte laut und für alle erzählen sollte.
„Ich denke, du solltest sie laut erzählen.“ Wieder antwortete Edward auf meine Gedanken und wieder traf es mich völlig überraschend. Welch seltsam irritierende Fähigkeit. Die Personen in seinem Umfeld hatten dadurch ja quasi gar keine Privatsphäre mehr. Und an dem gequälten Lächeln, das er mir zuwarf, konnte ich erraten, dass er sich diesem Umstand bewusst war und es ihm irgendwie auch Leid tat. Aber er konnte ja nun einmal nichts für seine Gabe.
Leise seufzend lehnte ich mich in dem Sessel zurück und erinnerte mich.
*Rückblick*
Mit offenen Augen lag ich in meinem Bett und starrte an die Decke. Tom lag neben mir und gab leise, schnaufende Atemgeräusche von sich. Er war gerade erst wieder eingeschlafen und würde mir nun ein paar Stunden Ruhe lassen, bevor er wieder nach seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Essen, verlangte. Und obwohl ich unendlich müde war und die paar Stunden Schlaf, die mein Sohn mir gönnte, dringend benötigt hätte, konnte ich die Augen einfach nicht zumachen. Mein Puls war leicht beschleunigt. Unter meinen gefalteten Händen hob und senkte sich meine Brust viel zu schnell um einzuschlafen. Ich war hochgradig beunruhigt. Edward hatte sehr schlecht ausgesehen, als er noch während des Abendessens das Haus verlassen hatte, um an das Krankenbett seiner Mutter zu eilen. Mich ließ das beklemmende Gefühl nicht los, dass Edward der nächste von uns sein würde, der erkrankte. Er war müde und ausgezerrt. Seit Tagen hatte er kaum richtig gegessen oder geschlafen und verbrachte Tag und Nacht in einem Krankenhaus voller Sterbender. Er wäre ein leichtes Opfer für die spanische Grippe gewesen. Wir hatten von Fällen gehört, da hatte es keine 24 Stunden gedauert, bis der Tod sein Opfer verschlungen hatte.
Ganz langsam breitete sich eine unangenehme Gänsehaut auf meinem Körper aus, sodass sich die feinen Härchen auf meinen Armen aufrichteten. Schnell zog ich mir die Decke bis ans Kinn, doch es änderte nichts an dem merklichen Frösteln. Erst Thomas, dann mein Onkel und nun meine Tante. Sollte Edward also als Nächster für meine Schuld büßen? Geräuschvoll zog ich die Nase hoch und drehte mich auf die Seite, um meinen Sohn im faden Mondschein zu betrachten. Sicherlich. Er war jedes Opfer wert, doch sollte nicht ich es sein, die für ihre Sünden zahlt und nicht die Anderen? Die Welt oder zumindest meine eigene Welt hatte sich in den letzten Wochen und Monaten so sehr verändert, dass ich es immer noch nicht geschafft hatte einen Platz darin zu finden und so langsam war ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob es wirklich für jeden Menschen einen Platz im Leben gab.
Zärtlich legte ich meine rechte Hand auf Toms Brust und spürte den gleichmäßigen, kräftigen Herzschlag. „Mein Platz ist da wo du bist. Ich liebe dich.“, flüsterte ich in die Dunkelheit und meinte damit gleichermaßen meinen Sohn, als auch meinen Mann. Doch ich liebe auch Edward, ebenso wie meine Tante oder Mary. Seit Monaten hatte ich nicht mehr gebetet. Nun erschien es mir, als sei der richtige Zeitpunkt gekommen, einen letzten Versuch zu unternehmen, mit Gott zu reden. Ich drehte mich zurück auf den Rücken und faltete die Hände. Meine Augen brannten bereits vor Müdigkeit, weshalb ich sie schloss. Ein fataler Fehler. Noch während ich überlegte, wie ich mein Gespräch mit dem Allmächtigen beginnen sollte, glitt ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf, ohne das ich mich dagegen hätte wehren können. Vielleicht hätte dieses Gebet ja irgendetwas an dem geändert, was in dieser Nacht geschah.
Ein seltsames Geräusch riss mich am frühen Morgen aus meinem komaartigen Zustand. Zuerst hatte ich gedacht es wäre Tom, der mal wieder vor seiner Zeit Appetit bekommen hatte, doch der Säugling lag wie ein warmer Stein neben mir. Die geballten Fäuste hatte er vor sich in die Luft gestreckt und sein schönes Gesicht war zu einer verkniffenen Grimasse verzogen, doch er schien zu schlafen. Ein Traum vielleicht. Auch das vermeintliche Geräusch, das mich geweckt hatte, war nun nicht mehr zu hören. Eine Einbildung? Kraftlos rieb ich mir mit dem Handrücken über meine müden Augen, bevor ich mich vorsichtig aufrichtete. Die Sonne ging bereits langsam auf und verfärbte die Welt vor meinem Fenster silbrig. Bald würde Tom so oder so aufwachen und Sidonie würde auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es lohnte sich also gar nicht mehr, sich noch einmal hinzulegen.
Gerade als meine nackten Füße den kalten Fußboden berührten, hörte ich es wieder. Eine Art Wummern. Verwundert drehte ich den Kopf in alle Richtungen. Ich war noch viel zu verschlafen, um es richtig zu orten. Doch dann wurde es lauter. Das Wummern schwoll zu einem Klopfen unten an der Haustür an. Wer klopfte denn um diese unchristliche Zeit? Erstaunt legte ich die Stirn in Falten, drückte mich aber vom Bett hoch, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Zuvor legte ich meinen Sohn allerdings noch schnell in sein eigenes Bettchen und warf mir meinen Morgenmantel über das spitzenverzierte Nachthemd. Da der Flur nur ein paar winzige Fenster besaß, war es hier noch fast vollständig dunkel, als ich die Tür öffnete und hinaustrat. Jemand klopfte tatsächlich an unsere Haustür. Es war keine Einbildung gewesen. Ganz im Gegenteil. Jemand schlug mit beiden Fäusten, in schierer Verzweiflung gegen das schwere Holz. „ANNI? MARY?“, brüllte eine Frauenstimme und wieder wurde kräftig gegen das Holz geschlagen. „ANNI?“ Erschrocken schloss ich schnell den Gürtel meines Mantels und hastete die Treppe hinab in die Empfangshalle.
Überstürzt riss ich mit viel zu viel Kraft die Haustür auf, sodass ich fast gestolpert und nach hinten gefallen wäre. Doch ich schaffte es noch in allerletzter Sekunde mein Gleichgewicht wiederzufinden und mich so vor dem Sturz zu bewahren. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich Georgia an, die nun vor mir stand. Sie trug ein schlichtes graues Leinenkleid mit einer weißen Schürze, wie sie alle Schwesternschülerinnen im Hospital trugen. Ihr blondes Haar hatte sie hochgesteckt, doch einige Strähnen hatten sich gelöst und blickten wirr unter ihrer Haube hervor. Wie die meisten Leute, wirkte auch sie in diesen Tagen mager und abgeschlagen. Ihre blauen Augen lagen tief in den Höhlen, die von schwarzen Ringen gezeichnet wurden. Unendliche Trauer ging von ihr aus.
‚Meine Tante‘, schoss es mir sofort durch den Kopf. Meine Tante war gestorben und Edward hatte Georgia geschickt, um mir diese traurige Botschaft zu überbringen. Mein Herz wurde unglaublich schwer und ich bereute es augenblicklich, auf meinen Cousin gehört zu haben. Ich hatte die letzte Chance verpasst meiner Tante für alles zu danken, was sie für mich getan hatte. Für all die Jahre, die sie mir eine Mutter gewesen war, als meine eigene sich geweigert hatte. Für all die schönen Stunden, die wir miteinander verbracht hatten. Ich hatte es versäumt, mich von ihr zu verabschieden. „Meine Tante?“ Ich brachte die Worte nur zögerlich über die Lippen, doch ich brauchte Gewissheit.
„Ja.“ Regentropfengroße Tränen liefen über Georgias Wangen. Sie zitterte am ganzen Leib, als sie einen Schritt auf mich zu machte und eine Hand auf meine Schulter legte. „Und Edward.“
Die Welt um mich herum blieb stehen, während mich gleichzeitig das pure Chaos erfasste. Immer wieder versuchte ich das Gesicht meiner Freundin zu taxieren, um in ihre Augen zu sehen. Doch ihre Silhouette verschwamm vor meinen Augen. Das konnte nur ein schlechter Scherz sein. Ein sehr böser und sehr makaberer Scherz. Edward war am Vorabend gewiss nicht die Gesundheit auf zwei Beinen gewesen, aber er war doch auch nicht so krank gewesen, dass es ihn innerhalb einer Nacht dahin gerafft hätte. „Du lügst“, flüsterte ich leise und begann in blinder Verzweiflung mit dem Kopf zu schütteln, bis mir schwindelig wurde.
„Nein Anni. Ich wünschte es wäre so.“ Ihre Stimme drang aus so weiter Entfernung an mein Ohr, dass ich nicht geglaubt hätte, dass sie neben mir stand. Allerdings konnte ich ihre Hände spüren. Eine, die mich am Arm festhielt, mit erstaunlich viel Kraft für einen so ausgemergelten Körper und die andere, die mir immer wieder beruhigend über den Rücken strich. „Deine Tante starb noch gestern Nacht. Edward hatte bereits sehr hohes Fieber. Ich wies ihn an sich hinzulegen, musste ihm aber versprechen mich um alles zu kümmern. Ich wollte direkt zu euch kommen, doch dann gab es so viele neue Patienten und ich habe es nicht geschafft. Als ich vorhin noch einmal nach ihm sehen wollte, da war er schon…“ Ihre Stimme erstarb in einer Flut von Tränen. „Ich bin sofort hergekommen“, fügte sie schluchzend hinzu.
„Du lügst“, wiederholte ich ein weiteres Mal und riss mich von ihr los. Tränen trübten meinen Blick, als ich los rannte. Ich rannte einfach hinaus auf die Straße, nur bekleidet mit meinem Nachthemd und dem Morgenmantel. An den Füßen trug ich nichts als meiner Haut, doch bemerkte ich weder die Kälte, noch den Unrat, auf den ich trat. Ich rannte einfach. Meine offenen Haare flogen im Wind hin und her und die wenigen Passanten, die sich um diese Uhrzeit bereits auf der Straße befanden, starrten mich an, doch es war mir egal. Mein Herz pochte mir bis zum Hals und mein Puls raste ob der plötzlichen Anstrengung. Ich ignorierte das Brennen meiner Lungen, obwohl ich das Gefühl hatte ersticken zu müssen. Ich lief und lief und lief. Stehen blieb ich erst, als ich die Pforte des Krankenhauses passiert hatte.
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Kapitel 11 Part 2
Die Luft in dem alten Gebäude war dick und stickig von den Ausdünstungen der Kranken, die sich hier fast zu stapeln schienen. Mit gehetztem Blick sah ich mich um. Wo konnte Edward sich befinden? Georgia hatte gesagt, dass sie ihn angewiesen hatte sich hinzulegen. Sicherlich in einem Bett. Also musste er sich in einem der zahllosen Zimmer befinden. Ich beschloss, mich nicht mit langer Fragerei beim Personal aufzuhalten, sondern machte lieber direkt Nägel mit Köpfen. Ich riss die Tür zum ersten Zimmer auf und ging im Laufschritt die Bettreihen ab. Doch von Edward keine Spur. Ebenso fegte ich durch das nächste und übernächste Zimmer, bis ich plötzlich mit einem Mann zusammenstieß.
„Kann ich Ihnen helfen, Miss?“ Rote Augen. Ich war mir sicher, dass ich nun vollkommen den Verstand verlor, doch als ich aufblickte, sah ich in ein Paar leicht rötlich verfärbter Augen. Ich schüttelte mich, um wieder klar im Kopf zu werden, doch die roten Augen blieben. Ich spürte eine Gänsehaut meinen Rücken hinab laufen. Der Mann vor mir war ganz in weiß gekleidet. Ein Arzt also. Vielleicht könnte er mir weiterhelfen.
„Masen. Ich suche Edward Masen.“ Obwohl ich nicht hatte schreien wollen, war meine Stimme ungewöhnlich laut.
„Oh. Mister Masen sagen Sie?“ Ich nickte. Aus irgendeinem Grund wich ich einen Schritt zurück. Vielleicht weil das kleine „oh“ von ihm schon gereicht hatte, um meine letzte kleine Hoffnung zu zerstören, vielleicht aber auch einfach nur, weil er mir Angst machte. Es waren diese Augen, die mich furchtbar irritierten und der Umstand, dass er noch viel, viel blasser war, als alle Anderen, obwohl er doch bei bester Gesundheit zu sein schien. „Und Sie sind?“
„Joanna Masen. Seine Cousine.“
Der Blick der grauenhaften, roten Augen nahm einen schmerzhaften Ausdruck an. Gerade so, als hätte ich ihm nicht meinen Namen gesagt, sondern die Fingernägel durch das perfekte Gesicht geschlagen.
„Ich dachte, er hätte keine Angehörigen mehr.“, erklärte er und machte zögerlich einen Schritt auf mich zu. „Es tut mir leid, Miss Masen, aber Ihr Cousin ist heute früh verstorben.“ Er wandte den Blick von mir ab, als könne er es selbst nicht ertragen, mir diese schreckliche Nachricht zu überbringen. „Ich habe angeordnet, ihn in einem Seuchengrab beizusetzen.“
„WAS?“ Entsetzen schnürte mir die Kehle zu, als ich die Fäuste ballte und auf ihn losgehen wollte. Blitzschnell erkannte er die Situation und umfasste meine Schulter so fest, dass es weh tat. Ich war nicht mehr in der Lage mich zu bewegen, doch ich schrie und schimpfte, fluchte und weinte, bis ich am Ende meiner Kräfte angelangt war. Und er mich wieder los ließ.
„Es tut mir wirklich aufrichtig leid, Miss Masen.“ Er führte mich zu einem Stuhl und drückte mich darauf nieder, dann verschwand er und ich blieb allein zurück. Vollkommen allein.
*Rückblick Ende*
Sieben Augenpaare wanderten unentwegt zwischen mir und Carlisle, dem ich mich nun zugewandt hatte, hin und her. „Sie waren der Arzt im Krankenhaus“, stellte ich überflüssiger Weise fest, da das wohl jedem klar zu sein schien. Trotzdem bestätigte er meine Vermutung mit einem zaghaften Nicken. „Sie haben Edward verwandelt."
„Kann ich Ihnen helfen, Miss?“ Rote Augen. Ich war mir sicher, dass ich nun vollkommen den Verstand verlor, doch als ich aufblickte, sah ich in ein Paar leicht rötlich verfärbter Augen. Ich schüttelte mich, um wieder klar im Kopf zu werden, doch die roten Augen blieben. Ich spürte eine Gänsehaut meinen Rücken hinab laufen. Der Mann vor mir war ganz in weiß gekleidet. Ein Arzt also. Vielleicht könnte er mir weiterhelfen.
„Masen. Ich suche Edward Masen.“ Obwohl ich nicht hatte schreien wollen, war meine Stimme ungewöhnlich laut.
„Oh. Mister Masen sagen Sie?“ Ich nickte. Aus irgendeinem Grund wich ich einen Schritt zurück. Vielleicht weil das kleine „oh“ von ihm schon gereicht hatte, um meine letzte kleine Hoffnung zu zerstören, vielleicht aber auch einfach nur, weil er mir Angst machte. Es waren diese Augen, die mich furchtbar irritierten und der Umstand, dass er noch viel, viel blasser war, als alle Anderen, obwohl er doch bei bester Gesundheit zu sein schien. „Und Sie sind?“
„Joanna Masen. Seine Cousine.“
Der Blick der grauenhaften, roten Augen nahm einen schmerzhaften Ausdruck an. Gerade so, als hätte ich ihm nicht meinen Namen gesagt, sondern die Fingernägel durch das perfekte Gesicht geschlagen.
„Ich dachte, er hätte keine Angehörigen mehr.“, erklärte er und machte zögerlich einen Schritt auf mich zu. „Es tut mir leid, Miss Masen, aber Ihr Cousin ist heute früh verstorben.“ Er wandte den Blick von mir ab, als könne er es selbst nicht ertragen, mir diese schreckliche Nachricht zu überbringen. „Ich habe angeordnet, ihn in einem Seuchengrab beizusetzen.“
„WAS?“ Entsetzen schnürte mir die Kehle zu, als ich die Fäuste ballte und auf ihn losgehen wollte. Blitzschnell erkannte er die Situation und umfasste meine Schulter so fest, dass es weh tat. Ich war nicht mehr in der Lage mich zu bewegen, doch ich schrie und schimpfte, fluchte und weinte, bis ich am Ende meiner Kräfte angelangt war. Und er mich wieder los ließ.
„Es tut mir wirklich aufrichtig leid, Miss Masen.“ Er führte mich zu einem Stuhl und drückte mich darauf nieder, dann verschwand er und ich blieb allein zurück. Vollkommen allein.
*Rückblick Ende*
Sieben Augenpaare wanderten unentwegt zwischen mir und Carlisle, dem ich mich nun zugewandt hatte, hin und her. „Sie waren der Arzt im Krankenhaus“, stellte ich überflüssiger Weise fest, da das wohl jedem klar zu sein schien. Trotzdem bestätigte er meine Vermutung mit einem zaghaften Nicken. „Sie haben Edward verwandelt."
Gast- Gast
 Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Re: Bis(s) das der Tod uns scheidet
Ich muss mich unendlich bei euch entschuldigen, dass ich mich hier so lange nicht hab blicken lassen. ich habe angefangen zu studieren, bin dementsprechend umgezogen, musste mich einleben, neue Leute kennenlernen, lernen etc. Da blieb für sowas eine keine Zeit. Aber jetzt bin ich wieder hier und hab sogar nen neues kap im gepäck, falls das überhaupt noch jemand lesen will.
Kapitel 12
Eins muss man Edward lassen – Er ist schnell. Verdammt schnell. Selbst für meine Augen fast schon zu schnell. Und so war es auch kaum verwunderlich, dass Bella einen leisen Schrei ausstieß, als Edward plötzlich nicht mehr auf seinem Platz saß, sondern sich zornig vor Carlisle aufgebaut hatte. Und alles was sie davon mitbekommen hatte war ein Lufthauch seiner Bewegung. „Du hast gesagt sie wären tot!“ Ein bedrohliches Knurren wuchs in seiner Brust, als er mit zusammen gebissenen Zähnen zu seinem Ziehvater sprach. Scheinbar hatte mein Cousin seine Erinnerungen wiedergefunden. Dann drehte er sich blitzschnell zu mir um und strich mit den langen weißen Fingern seiner rechten Hand über meine Wange. Ich schaffte es gerade noch selbst aufzustehen, als er auch schon wieder direkt vor mir stand.
„Es tut mir so leid, Joanna – Anni. Die Verwandlung… tagelang war ich unter starken Schmerzen in einer Zwischenwelt gefangen. Ich wusste kaum noch wo oben und wo unten war. So viel war zuvor passiert. So viele waren gestorben. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wer noch lebte oder schon gegangen war, als ich wieder erwachte. Carlisle hat mir gesagt, ich hätte niemanden mehr und ich habe ihm geglaubt. Anni, du musst mir verzeihen. Ich hatte es nicht gewusst. Ich hatte dich nicht allein lassen wollen.“ Vor Rührung, die diese Worte in mir auslösten zog ich ein schiefes Lächeln. Edward hatte genau wie ich nie eine Wahl gehabt. Ich konnte ihn keinen Vorwurf machen, hatte es nie getan. Aber ich hatte auch immer gedacht, das Edward tot war und niemals hätte zu mir zurück kommen können.
„Edward, bitte hör mich an.“ Auch Carlisle hatte sich von seinem Platz erhoben. Man merkte ihm sofort an, dass er das Oberhaupt dieses Clans war. Seine Art zu reden, seine Ausstrahlung, seine Präsens und seine Autorität ließen keinen Zweifel. Und Edward folgte dem Ruf seines Anführers, egal wie sehr er sich auch dagegen sträuben mochte. Widerwillig machte er eine halbe Drehung auf den Fersen und sah den Älteren an. „Ich hatte es nicht gewusst. Ich hatte wirklich gedacht, dass du allein wärst. Deine Mutter, sie hat im Fieber zu mir gesprochen. Sie hat gesagt ich soll dich retten. Ich…“ Verzweiflung zeichnete Carlisles perfektes Gesicht. Zarte Linien wirkten auf der marmorgleichen Haut wie tiefe Furchen.
„Das du dachtest, ich hätte keine Angehörigen mehr, als du mich verwandelt hast ist die eine Sache“, knurrte Edward ihn an. „Das du mich aber belogen hast, als du es besser wusstest, das ist die andere.“
Ein wenig zerknirscht sah ich von Edward zu Carlisle, der unter den Vorwürfen seines Ziehsohns zu schrumpfen schien. Schuld stand in den weisen Augen und der Vampir tat mir plötzlich aufrichtig leid, obwohl er nicht nur Edward, sondern auch mich belogen hatte. So vieles hätte für uns beide einfacher sein können, wenn er damals wenigstens ihm Edward die Wahrheit gesagt hatte. Es war eine der Vampirfrauen – Esme hatte Edward sie genannt – die sich schließlich vor ihren Gefährten stellte und ihren Ziehsohn mahnend ansah. Noch nie zuvor hatte ich eine Vampirin getroffen, die eine solche Mütterlichkeit und Liebe ausstrahlte. Fasziniert betrachte ich nun auch sie eingehender.
„Hör auf ihm Vorwürfe zu machen, Edward!“, ermahnte sie meinen Cousin und ihr Tonfall war strenger, als ich ihr zugetraut hätte. „Hast du in deinem Leben noch nie Fehler gemacht? Bist du immer nur auf den Pfaden der Wahrheit und Tugend gewandelt?“ Sie machte eine kurze Pause, die allerdings eher theatralischer Natur war. Eine Antwort erwartete sie nicht. „Nein, dass bist du nicht. Das bist du sogar ganz sicher nicht und wir alle wissen das. Und wir alle haben stets Verständnis für dich gehabt. Es ist nicht immer leicht die richtigen Entscheidungen zu treffen und Carlisle hat diese Entscheidung getroffen, weil er dich liebt. Weil er dich schützen wollte und weil er Anni schützen wollte. Was hätte es denn geändert, wenn du von ihr gewusst hättest?“ Wieder eine theatralische Pause. Die Stille, die jetzt im Raum herrschte wirkte fast schon greifbar. Alle Vampire hatte sowohl das atmen, als auch das bewegen vollkommen eingestellt.
Für einen kurzen Moment schien es so, als wollte Edward irgendetwas sagen, doch Esme hob gebieterisch die Hand um ihm zu signalisieren, dass sie mit ihrem Vortrag noch lange nicht fertig war. „Es hätte nichts geändert, Edward. Gar nichts! Du warst ein neugeborener Vampir. Du warst gefährlich, Edward. Du hast Menschen getötet!“ Ihre Stimme war absichtlich ätzend. Ich konnte hören, wie Bella irgendwo neben mir tiefer einatmete als normal. Scheinbar zählte es nicht gerade zu ihrem Lieblingsthemen, dass Vampire zuweilen auch gerne mal den einen oder anderen Menschen leer saugten. Ich machte ihr daraus keinen Vorwurf. „Was hättest du also getan, wenn du von Anni gewusst hättest? Wärst du zu ihr gegangen und weiterhin ihr liebevoller, blutsaugender Cousin gewesen, der schließlich ganz ausversehen mal die Kontrolle verliert und seine Cousine zum Frühstück verputzt?“
Ich gab mich einem kurzen Moment dieser obskuren Vorstellung hin und verzog das Gesicht, konzentrierte mich dann aber wieder auf die Vorstellung vor mir. „Du hättest nichts tun können, Edward. Du wärst eine Gefahr für sie gewesen und somit in gewisser Weise auch für dich. Carlisle hat oft mit sich gerungen es dir zu sagen, aber er wollte dich schließlich nur schützen. Dein Stolz und dein Pflichtgefühl hätten dich doch auch im Nachhinein noch um den Verstand gebracht. Wir lieben dich, so wie du bist. Wir akzeptieren deine Entscheidungen so wie du sie triffst.“ Er Blick huschte kurz zu Bella und dann wieder zurück zu Edward. „Wenn du nun also glaubst, dass ich es zulasse, dass du Carlisle wegen dieser Entscheidung einen Vorwurf machst, dann hasst du dich ganz schön tief geschnitten, mein Lieber. Wenn du nicht einmal Verständnis dafür aufbringen kannst, dass er aus Pflichtgefühl Anni gegenüber und aus Liebe zu dir gelogen hat – und er lügt nicht oft wie du weißt, jedenfalls nicht halb so oft wie du – dann weißt du wo die Tür ist.“ Mit dem ausgestreckten Zeigefinger deutete Esme auf die Haustür und beendete mit dieser Geste ihre Rede.
Und wieder herrschte Stille. Für einen kurzen Augenblick fragte ich mich, wo ich hier eigentlich hinein geraten war. Ich hatte die letzten Jahre fast ausschließlich unter Menschen verbracht und war scheinbar nicht hinreichend damit vertraut, wie Vampire in großen Gruppen, heutzutage zusammen lebten. Dies hier kam mir allerdings so vor, als wäre Edward tatsächlich nicht mehr als ein 17 jähriger Junge, der von seiner Mutter gemaßregelt wurde, ob dem mangelnden Respekt seinem Vater gegenüber. Erst jetzt schaffte ich es, mich von der Szene los zu reißen und mich im Raum umzusehen.
„Wow! Das war krass“, flüsterte der große Vampir, der mir so unhöflich in die Rippen getreten hatte, seiner Freundin zu. Die Blondine nickte kaum merklich, ohne ihren Blick von Esme und Edward abzuwenden. „Und irgendwie ganz schön unheimlich.“ Die Bewegung ihrer vollen, sinnlichen Lippen wäre für das menschliche Auge nicht sichtbar gewesen. Die kleine Vampirin, saß im Schneidersitz auf dem Boden und hatte ihren Rücken an die Beine ihres Freundes gelehnt. Sie wirkte relativ gelangweilt von den Geschehnissen. Ihr Freund hingegen schien wachsam. Beobachtete alles ganz genau, als erwartete er, dass er eingreifen müsste. Ich hielt es allerdings als ziemlich unwahrscheinlich, dass Edward seine Ziehmutter angreifen würde. Er schien eher völlig irritiert. Ebenso wie Bella, die versuchte sich in einer Ecke des Sofas zu verstecken.
Ein leises Seufzen durchbrach endlich die unerträgliche Stille. Edwards Seufzen. Zaghaft machte er einen Schritt zur Seite, um an Esme vorbei zu Carlisle zu sehen. „Es tut mir leid. Ich bin mir sicher, dass du deine Gründe hattest. Ich… Ich wollte dich nicht anschreien. Ich war nur so… so überrascht?“
„Schon gut.“ Carlisle machte eine abwinkende Geste. „Wahrscheinlich hab ich einen Fehler gemacht. Aber ich habe es damals für das Richtige gehalten. Und später wollte ich dich nicht mehr damit belasten. Ich… Es konnte ja niemand ahnen, dass…“ Unsicher ließ er seinen Blick über mich schweifen und zuckte, fast schon verzweifelnd wirkend mit den starken Schultern. „Woher hätte ich denn wissen sollen, dass deine Cousine inzwischen ebenfalls ein Vampir geworden ist?“
Es schien, als hätte Edward mich bereits vergessen gehabt, doch wahrscheinlich wollte er nur von dem Streit mit Esme ablenken, als er sich nun wieder zu mir umdrehte. „Und du wolltest uns noch erzählen, wie es dazu gekommen ist.“ Ohne zu protestieren ließ ich mich von ihm wieder zu dem Sessel führen und ließ mich hineinfallen. Ich wartete, bis jeder wieder saß, blickte in ihre neugierigen Augen und versuchte, mich zu erinnern.
*Rückblick*
Ich saß einfach nur so da und starrte ins Leere. Aufgeregte Krankenschwestern zogen ebenso an mir vorbei wie stöhnende Patienten und Befehle gebende Ärzte. Ich sah sie alle. Ich konnte sie auch hören, doch ich nahm sie nicht wahr. Ich fühlte mich unfähig mich zu bewegen. Unfähig, meinen Kopf auch nur für wenige Millimeter zu drehen. Was zu viel ist, ist einfach zu viel. In diesem Jahr waren nicht nur zu viele Menschen gestorben, die ich aus ganzem Herzen geliebt hatte, sondern auch ein Teil meiner Welt. Ich war noch nicht einmal dazu in der Lage, zusammen zu zucken, als mich jemand überraschenderweise an der Schulter berührte.
„Anni?“ Ich hörte jemanden meinen Namen sagen und spürte, dass jemand sanft an meiner Schulter rüttelte. Doch ich wusste nicht wer es war. Ich fühlte mich außer Stande zu sagen, ob die Stimme zu einem Mann oder einer Frau gehörte. „Anni?“ Wieder nannte jemand meinen Namen und ein bekanntes Gesicht schob sich in mein vernebeltes Blickfeld. Es war Georgia. Irgendwie schaffte ich es meinen Kopf ein wenig zu heben und sah Mary ein paar Schritte hinter unserer Freundin stehen. Sagen konnte ich nichts. Was hätte ich auch sagen sollen? Worte hätten nichts geändert an dem kleinen Tod, den ich heute gestorben war.
Widerstandslos ließ ich zu, dass sich Georgia links und Mary rechts von mir unterhakte und die beiden mich aus dem Spital führten. Langsam und träge setzte ich einen Fuß vor den anderen, ohne dass ich meinen Beinen den Befehl dazu gegeben hätte. Hätte Mary und Georgia mich nicht festgehalten, ich wäre wohl der Länge nach hingeschlagen und einfach auf der Straße liegen geblieben, dem war ich mir sicher. Die große Leere, die ich verspürte, nahm jeden Zentimeter meines Körpers, meines Herzens und meiner Seele in Besitzt, als wäre ein Dämon in mich eingefahren, um mich von innen heraus aufzufressen. Erst als wir vor dem Haus stehen blieben, in dem ich einst ein glückliches Leben im Kreise meines Onkels, meiner Tante und Edward geführt hatte, kehrte wieder etwas Leben zurück in meine Geist und meine Glieder. Ich wollte nicht in dieses Haus gehen. Ich war mir sicher, dass ich genauso wahnsinnig werden wie Marys Mutter, wenn ich an den Ort zurück kehren würde, an dem mich alles an sie erinnern würde.
Jähe Panik ergriff mich. Ich riss mich von meinen Freundinnen los, die mich bereits zum Fuße der Portaltreppe geführt hatten und begann zu schreien. Für einen kurzen Moment registrierte ich Marys, vor Schreck geweiteten Augen, doch ich konnte keine Rücksicht darauf nehmen, ob ich irgendjemandem Angst einjagte. Ich wollte hier weg. Ich konnte nicht in dieses Haus gehen. „NEIN!“, schrie ich aus Leibeskräften, während ich auf meinen blanken Füßen kehrt machte, um in die andere Richtung zu laufen. Doch meine Beine trugen mich nicht ohne Hilfe. Ich geriet ins straucheln, wäre gestürzt, wäre Georgia nicht sofort zur Stelle gewesen und riss mich am Handgelenk wieder in die Senkrechte. Doch ihr fester Griff machte mir nur noch mehr Angst. Ich fürchtete, dass sie mich nun doch an diesen grauenvollen Ort der Erinnerungen bringen würde.
Durch mein Schreien, war nun auch Sidonie aufgeschreckt worden. Meinen Sohn auf dem Arm trat sie aus der Haustür und sah bedrückt zu uns herab. Ich bekam das nicht mit. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, mich von Georgia zu befreien. Ich riss heftig an meinem Arm, um ihn los zu bekommen, schlug nach meiner Freundin und versuchte ihre Haare zufasse zu bekommen, um sie ihr auszureißen. Ich war das perfekte Bild, einer verzweifelten und wild gewordenen Furie. „Anni! Hör sofort auf damit!“ Nun war auch Mary wieder aus ihrer Schreckensstarre erwacht und versuchte von hinten, mich von Georgia los zu reißen. Wir müssen schon ein äußerst seltsames Bild abgegeben haben. Drei Frauen, die sich im Vorgarten eines ziemlich vornehmen Hauses geradezu prügelten, wobei Mary nur unzureichend gekleidet war in der Hast der sie am Morgen hatte folgen müssen und ich, die ich lediglich im Nachthemd und Morgenmantel auf dem Rasenstand und immer wieder „NEIN! NEIN! NEIN!“, schreite.
Zu zweit waren die beiden dann allerdings doch stärker als ich. Sie keilten mich zwischen sich ein. Meine Arme hielten sie dabei so fest, dass ich sie kaum noch bewegen konnte. Meine Haut unter ihren Fingern wurde ganz weiß. „Wir bringe sie nach nebenan!“, bestimmte Mary, wobei sie einen unsicheren Blick zu ihrem Elternhaus warf. Mary hatte es vermieden, das Haus zu betreten, seit ihr Vater mit ihrer Mutter nach Oregon aufgebrochen war und nicht mehr zurück kehrte. Doch sie riss sich zusammen. Demonstrierte nicht so armselig wie ich, welche Angst sie vor den Erinnerungen an die Toten hatte. Stattdessen richtet sie sich zu ihrer vollen Größe auf und straffte die Schultern, wie sie es immer tat wenn eine Aufgabe vor ihr lag, die ihr alles abverlangte. Mit einem leisen Pfiff, blies sie sich eine verirrte Haarsträhne aus dem Gesicht, dann ging sie los. Unbarmherzig zwischen Georgia und Mary eingeklemmt hatte ich keine andere Wahl, als mit ihnen zu gehen. Sidonie folgte uns mit Tom.
In dem großen Herrenhaus war dunkel. Seit über einem halben Jahr war niemand mehr hier gewesen. Sidonie hatte im Auftrag meiner Tante die Möbel im Salon mit Bettlaken abgedeckt, damit der samtene Bezug vom Staub nicht zerstört werden konnte. Es wirke ein wenig wie ein Geisterhaus. Spinnenweben hingen in jeder Ecke unter den Decken und das dunkle Holz der großen Treppe, die in die obere Etage führte hatte den Glanz aus früheren Tagen verloren. „Wir bringen sie am besten in mein Zimmer“, ordnete meine Schwägerin nach einem kurzen Moment des Schweigens schließlich an. Scheinbar hatte sie einen Moment lang darüber nachgedacht, mich in Thomas´ altem Zimmer unterzubringen. Das allerdings wäre meinem Zustand wohl nur wenig dienlich gewesen. Ich wehrte mich jetzt nur noch kaum gegen die festen Griffe meiner Freundinnen und lies mich von ihnen nach oben bringen.
Die Türen zu den Schlafzimmern waren verschlossen und die Tür zu Marys Zimmer quietschte laut, als sie aufgestoßen wurde. Im Inneren des großzügig geschnittenen Raumes sah es ebenso aus, wie in jedem Mädchenzimmer. Es gab eine Frisierkommode, auf der ein paar Flakons mit Flüssigkeiten standen. Ein Schmuckkämmchen lag einsam auf der ansonsten leeren Tischplatte. Die mit reichlichen Schnitzereien verzierten Schubladen, waren alle sorgsam verschlossen. Es war wahrscheinlich, dass sie dieselben Geheimnisse beherbergten, wie die Frisiertische anderer junger Frauen auch. Briefe von heimlichen Verehrern, kleine Dinge die man gefunden hat und an denen man Gefallen gefunden hatte, ein Buch, dass an aus Gründen der Anstandswahrung als Frau auf gar keinen Fall lesen sollte und so weiter und so fort. Vor der Kommode stand ein Hocker aus demselben dunklen Ebenholz aus dem fast alle Möbel im Haus der Sommers gefertigt war. Ebenso das große Bett von Mary, das zwar ordentlich gemacht war, allerdings voller Staub. Am Fuße des Bettes stand eine große Kiste, in der Marys Kleider eins gelagert wurden, bevor Sidonie sie zu uns rüber geholt hatte. Unter einem der großen Fenster gab es ein breiteres Fensterbrett, auf dem dünne Kissen lagen und zu hinsetzen einluden. Eine abgeliebte Puppe aus Porzellan, in einem ausgeblichenen gelben Kleid saß dort und betrachtete uns stumm.
„Ich beziehe das Bett neu.“ Sidonie war wie immer sofort zur Stelle, wenn es darum ging Ordnung und Sauberkeit wieder herzustellen. „Miss Anni?“ Mit einem stechenden Blick, der mich dazu auffordern sollte, mich zusammen zu reißen, hielt sie mir meinen Sohn hin. Ich zögerte kurz und sah zu Mary und Georgia. Letztere nickte und sie ließen meine Arme los, damit ich meinen Sohn halten konnte. Sanft drückte ich seinen kleinen Kopf an meine Wange, während ich ihn in meinen schmerzenden Armen wiegte und ein wenig Wärme kehrte zurück in mein Herz.
Die folgenden Wochen zogen einfach so an mir vorbei. Die Sonne ging morgens auf und abends wieder unter aber das war auch schon das einzige, das noch so war, wie früher. Alles andere hatte sich verändert. Nur Tom schaffte es hin und wieder mich aus meiner tiefen Lethargie zu reißen. Er brauchte mich. Er war ein Teil von mir. Es war meine Pflicht als seine Mutter mich um ihn zu kümmern und ihm die Liebe und Freude zu schenken, die er brauchte. Nur langsam fand ich wieder zu mir selbst zurück, beziehungsweise zu dem, was von mir selbst noch übrig war. Mary schaffte es sogar, mich nach zwei Wochen zu überreden, rauszugehen um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Ich war blass und sah krank aus. Versuchte mich auf das Gespräch zu konzentrieren, dass Mary mehr mit sich selber führte. „Misses Dashworth hat erzählt, dass die spanische Grippe nun langsam wieder nachlässt. Es gibt kaum noch neue Opfer und immer mehr Erkrankte überleben. Und Georgia meinte, dass viele Ärzte im Krankenhaus glauben, dass dieser Fluch nun langsam abziehen würde. Also das Grippe nicht wie beim letzten Mal nur eine Pause einlegt, sondern, dass sie ganz verschwindet. Ein Arzt hat deswegen wohl gestern auch gekündigt weil er meinte, hier in Chicago würde nun nicht mehr so viel Hilfe benötigt wie anderer Orts.“ Ich lauschte ihren Worten angestrengt und versuchte jeden Blick zu dem Haus zu vermeiden, in dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht hatte.
Doch es gelang mir nicht. Unbewusst glitt mein Blick immer wieder zu dem Gebäude aus weißem Sandstein. Mit der schweren Holztür die offen stand. Verwundert blieb ich stehen und Marys Blick folgte dem meinen. Sie spürte meine Verwunderung und dieselbe Vermutung keimt in ihr auf, wie in mir. „Vielleicht ist Sidonie kurz rüber gegangen um etwas zu holen?“, versuchte sie uns beide zu beruhigen, doch leider ohne Erfolg. „Sidonie ist auf dem Markt.“ Meine Stimme klang heiser, weil ich so lange geschwiegen hatte. Unwillig aber mit großen Schritten bewegte ich mich auf das Portal zu, überwand meine Angst und stieg die Treppe zur Haustür hinauf. Vorsichtig blickte ich durch die geöffnete Tür ins Innere des Hauses. „Hallo?“ Meine Stimme war leise und ich hätte wahrscheinlich auch keine Antwort bekommen, wenn irgendjemand mich gehört hätte.
„Wir sollten da besser nicht rein gehen.“ Mary war mir die Stufen hinauf gefolgt und hinter mir zu stehen gekommen. Auch sie blickte verängstigt, über meine Schulter in die Dunkelheit im Inneren. Ich scherte mich nicht um ihre Bedenken und trat ein. Ich musste es einfach tun. Ich brauchte Gewissheit. In der großen Halle sah alles aus wie immer, aber das war auch nicht weiter verwunderlich. Sollten wirklich Einbrecher hier gewesen sein, so hätten sie in der Halle nichts von Wert gefunden. Im Salon allerdings wurde meine Befürchtung bestätigt. Sämtliche Schranktüren waren aufgerissen worden. Auf den ersten Blick fiel mir auf, dass die Schatullen mit den Barschaften meines Onkels verschwunden waren. Auch dass der Schrank hinter dem Schreibtisch meines Onkels, verdächtig zur Seite geschoben worden war, bereitete mir Sorgen. Mit zitternden Knien ging ich darauf zu und mit Entsetzen sah ich das leere Loch in der Wand hinter dem Schrank. Hier hatte jemand genau gewusst, wonach er suchte. Ich schluckte schwer. Nur einmal hatte ich die kleine Kiste aus Holz gesehen, die mit rotem Seidenbrokat bezogen worden war. Nur einmal hatte meine Tante mir ihren ganz persönlichen Schatz gezeigt. Die Diamanten, die bereits seit Generationen in ihrer Familie waren.
Ich war zehn gewesen, als meine Tante mich in dieses kleine Geheimnis einweihte. Andächtig hatte sie die schöne Schachtel aus ihrem Versteck geholt und mir den Inhalt gezeigt. Als ich die Pracht der Edelsteine darin sah stockte mir fast der Atem. Drei kleine Anhänger lagen, auf Seide gebettet darin. In ihrer Lupenreinheit brach sich der Sonnenschein der durch die Fenster drang und erzeugte tanzende Regenbogen. Jeder Anhänger war in mühevoller Kleinarbeit in verschiedene Formen gebracht worden. Ein Anhänger war ein in Gold gefasstes Oval. Ein weiterer ein kleines Herz. Und der dritte war ein kleiner Schmetterling, der wundervoll funkelte. Ich konnte nicht aufhören ihn anzusehen.
„Weißt du Liebes“, hatte meine Tante gesagt und mir liebevoll mit einem Finger über die Wange gestreichelt. „diese Steine sind Familienerbstücke. Wenn ich eines Tages sterbe, dann wird Edward sie bekommen, damit seine Frau sie tragen kann und später an ihre Kinder weitervererbt.“ Meine Enttäuschung überspielend versuchte ich möglichst verständnisvoll zu nicken. Ich war es bereits gewöhnt, dass ich niemals ganz zu dieser Familie gehören würde. Ich wurde geliebt und niemals hätte man mich spüren lassen, dass ich nur ein Ziehkind war. Aber es waren eben die kleinen Momente, die sich wie ein glühendes Messer in mein kleines Herz bohrten. Ein Lächeln umspielte die Lippen meiner Tante, als sie weiter sprach. „Da du aber genauso mein Kind bis wie Edward, will ich, dass du den Schmetterling bekommst. Er soll dich daran erinnern, wer du bist und zu wem du gehörst.“ Ehrfürchtig sah ich zu ihr auf. Der Mund stand mir ein Stück weit offen. „Mach den Mund zu.“ Einen Zeigfinger unter mein Kinn gelegt, schloss meine Tante meinen Mund, bevor sie mir einen Kuss auf die Schläfe hauchte. „Du weißt genau wie sehr ich die liebe.“
Und jetzt? Meine Tante war tot. Edward ebenfalls. Und auch ein Schmetterling aus Diamant hätte diesen Verlust niemals wieder gut machen können. Doch für einen kurzen Moment fragte ich mich, wie ich mich denn nun daran erinnern sollte, wer ich bin und zu wem ich gehöre. Ich schluchzte laut, als mich die Erkenntnis fest in ihren Schraubstock nahm.
Ich wusste nicht mehr wo ich bin und wo mein Platz im Leben war.
*Rückblickende*
Kapitel 12
Eins muss man Edward lassen – Er ist schnell. Verdammt schnell. Selbst für meine Augen fast schon zu schnell. Und so war es auch kaum verwunderlich, dass Bella einen leisen Schrei ausstieß, als Edward plötzlich nicht mehr auf seinem Platz saß, sondern sich zornig vor Carlisle aufgebaut hatte. Und alles was sie davon mitbekommen hatte war ein Lufthauch seiner Bewegung. „Du hast gesagt sie wären tot!“ Ein bedrohliches Knurren wuchs in seiner Brust, als er mit zusammen gebissenen Zähnen zu seinem Ziehvater sprach. Scheinbar hatte mein Cousin seine Erinnerungen wiedergefunden. Dann drehte er sich blitzschnell zu mir um und strich mit den langen weißen Fingern seiner rechten Hand über meine Wange. Ich schaffte es gerade noch selbst aufzustehen, als er auch schon wieder direkt vor mir stand.
„Es tut mir so leid, Joanna – Anni. Die Verwandlung… tagelang war ich unter starken Schmerzen in einer Zwischenwelt gefangen. Ich wusste kaum noch wo oben und wo unten war. So viel war zuvor passiert. So viele waren gestorben. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wer noch lebte oder schon gegangen war, als ich wieder erwachte. Carlisle hat mir gesagt, ich hätte niemanden mehr und ich habe ihm geglaubt. Anni, du musst mir verzeihen. Ich hatte es nicht gewusst. Ich hatte dich nicht allein lassen wollen.“ Vor Rührung, die diese Worte in mir auslösten zog ich ein schiefes Lächeln. Edward hatte genau wie ich nie eine Wahl gehabt. Ich konnte ihn keinen Vorwurf machen, hatte es nie getan. Aber ich hatte auch immer gedacht, das Edward tot war und niemals hätte zu mir zurück kommen können.
„Edward, bitte hör mich an.“ Auch Carlisle hatte sich von seinem Platz erhoben. Man merkte ihm sofort an, dass er das Oberhaupt dieses Clans war. Seine Art zu reden, seine Ausstrahlung, seine Präsens und seine Autorität ließen keinen Zweifel. Und Edward folgte dem Ruf seines Anführers, egal wie sehr er sich auch dagegen sträuben mochte. Widerwillig machte er eine halbe Drehung auf den Fersen und sah den Älteren an. „Ich hatte es nicht gewusst. Ich hatte wirklich gedacht, dass du allein wärst. Deine Mutter, sie hat im Fieber zu mir gesprochen. Sie hat gesagt ich soll dich retten. Ich…“ Verzweiflung zeichnete Carlisles perfektes Gesicht. Zarte Linien wirkten auf der marmorgleichen Haut wie tiefe Furchen.
„Das du dachtest, ich hätte keine Angehörigen mehr, als du mich verwandelt hast ist die eine Sache“, knurrte Edward ihn an. „Das du mich aber belogen hast, als du es besser wusstest, das ist die andere.“
Ein wenig zerknirscht sah ich von Edward zu Carlisle, der unter den Vorwürfen seines Ziehsohns zu schrumpfen schien. Schuld stand in den weisen Augen und der Vampir tat mir plötzlich aufrichtig leid, obwohl er nicht nur Edward, sondern auch mich belogen hatte. So vieles hätte für uns beide einfacher sein können, wenn er damals wenigstens ihm Edward die Wahrheit gesagt hatte. Es war eine der Vampirfrauen – Esme hatte Edward sie genannt – die sich schließlich vor ihren Gefährten stellte und ihren Ziehsohn mahnend ansah. Noch nie zuvor hatte ich eine Vampirin getroffen, die eine solche Mütterlichkeit und Liebe ausstrahlte. Fasziniert betrachte ich nun auch sie eingehender.
„Hör auf ihm Vorwürfe zu machen, Edward!“, ermahnte sie meinen Cousin und ihr Tonfall war strenger, als ich ihr zugetraut hätte. „Hast du in deinem Leben noch nie Fehler gemacht? Bist du immer nur auf den Pfaden der Wahrheit und Tugend gewandelt?“ Sie machte eine kurze Pause, die allerdings eher theatralischer Natur war. Eine Antwort erwartete sie nicht. „Nein, dass bist du nicht. Das bist du sogar ganz sicher nicht und wir alle wissen das. Und wir alle haben stets Verständnis für dich gehabt. Es ist nicht immer leicht die richtigen Entscheidungen zu treffen und Carlisle hat diese Entscheidung getroffen, weil er dich liebt. Weil er dich schützen wollte und weil er Anni schützen wollte. Was hätte es denn geändert, wenn du von ihr gewusst hättest?“ Wieder eine theatralische Pause. Die Stille, die jetzt im Raum herrschte wirkte fast schon greifbar. Alle Vampire hatte sowohl das atmen, als auch das bewegen vollkommen eingestellt.
Für einen kurzen Moment schien es so, als wollte Edward irgendetwas sagen, doch Esme hob gebieterisch die Hand um ihm zu signalisieren, dass sie mit ihrem Vortrag noch lange nicht fertig war. „Es hätte nichts geändert, Edward. Gar nichts! Du warst ein neugeborener Vampir. Du warst gefährlich, Edward. Du hast Menschen getötet!“ Ihre Stimme war absichtlich ätzend. Ich konnte hören, wie Bella irgendwo neben mir tiefer einatmete als normal. Scheinbar zählte es nicht gerade zu ihrem Lieblingsthemen, dass Vampire zuweilen auch gerne mal den einen oder anderen Menschen leer saugten. Ich machte ihr daraus keinen Vorwurf. „Was hättest du also getan, wenn du von Anni gewusst hättest? Wärst du zu ihr gegangen und weiterhin ihr liebevoller, blutsaugender Cousin gewesen, der schließlich ganz ausversehen mal die Kontrolle verliert und seine Cousine zum Frühstück verputzt?“
Ich gab mich einem kurzen Moment dieser obskuren Vorstellung hin und verzog das Gesicht, konzentrierte mich dann aber wieder auf die Vorstellung vor mir. „Du hättest nichts tun können, Edward. Du wärst eine Gefahr für sie gewesen und somit in gewisser Weise auch für dich. Carlisle hat oft mit sich gerungen es dir zu sagen, aber er wollte dich schließlich nur schützen. Dein Stolz und dein Pflichtgefühl hätten dich doch auch im Nachhinein noch um den Verstand gebracht. Wir lieben dich, so wie du bist. Wir akzeptieren deine Entscheidungen so wie du sie triffst.“ Er Blick huschte kurz zu Bella und dann wieder zurück zu Edward. „Wenn du nun also glaubst, dass ich es zulasse, dass du Carlisle wegen dieser Entscheidung einen Vorwurf machst, dann hasst du dich ganz schön tief geschnitten, mein Lieber. Wenn du nicht einmal Verständnis dafür aufbringen kannst, dass er aus Pflichtgefühl Anni gegenüber und aus Liebe zu dir gelogen hat – und er lügt nicht oft wie du weißt, jedenfalls nicht halb so oft wie du – dann weißt du wo die Tür ist.“ Mit dem ausgestreckten Zeigefinger deutete Esme auf die Haustür und beendete mit dieser Geste ihre Rede.
Und wieder herrschte Stille. Für einen kurzen Augenblick fragte ich mich, wo ich hier eigentlich hinein geraten war. Ich hatte die letzten Jahre fast ausschließlich unter Menschen verbracht und war scheinbar nicht hinreichend damit vertraut, wie Vampire in großen Gruppen, heutzutage zusammen lebten. Dies hier kam mir allerdings so vor, als wäre Edward tatsächlich nicht mehr als ein 17 jähriger Junge, der von seiner Mutter gemaßregelt wurde, ob dem mangelnden Respekt seinem Vater gegenüber. Erst jetzt schaffte ich es, mich von der Szene los zu reißen und mich im Raum umzusehen.
„Wow! Das war krass“, flüsterte der große Vampir, der mir so unhöflich in die Rippen getreten hatte, seiner Freundin zu. Die Blondine nickte kaum merklich, ohne ihren Blick von Esme und Edward abzuwenden. „Und irgendwie ganz schön unheimlich.“ Die Bewegung ihrer vollen, sinnlichen Lippen wäre für das menschliche Auge nicht sichtbar gewesen. Die kleine Vampirin, saß im Schneidersitz auf dem Boden und hatte ihren Rücken an die Beine ihres Freundes gelehnt. Sie wirkte relativ gelangweilt von den Geschehnissen. Ihr Freund hingegen schien wachsam. Beobachtete alles ganz genau, als erwartete er, dass er eingreifen müsste. Ich hielt es allerdings als ziemlich unwahrscheinlich, dass Edward seine Ziehmutter angreifen würde. Er schien eher völlig irritiert. Ebenso wie Bella, die versuchte sich in einer Ecke des Sofas zu verstecken.
Ein leises Seufzen durchbrach endlich die unerträgliche Stille. Edwards Seufzen. Zaghaft machte er einen Schritt zur Seite, um an Esme vorbei zu Carlisle zu sehen. „Es tut mir leid. Ich bin mir sicher, dass du deine Gründe hattest. Ich… Ich wollte dich nicht anschreien. Ich war nur so… so überrascht?“
„Schon gut.“ Carlisle machte eine abwinkende Geste. „Wahrscheinlich hab ich einen Fehler gemacht. Aber ich habe es damals für das Richtige gehalten. Und später wollte ich dich nicht mehr damit belasten. Ich… Es konnte ja niemand ahnen, dass…“ Unsicher ließ er seinen Blick über mich schweifen und zuckte, fast schon verzweifelnd wirkend mit den starken Schultern. „Woher hätte ich denn wissen sollen, dass deine Cousine inzwischen ebenfalls ein Vampir geworden ist?“
Es schien, als hätte Edward mich bereits vergessen gehabt, doch wahrscheinlich wollte er nur von dem Streit mit Esme ablenken, als er sich nun wieder zu mir umdrehte. „Und du wolltest uns noch erzählen, wie es dazu gekommen ist.“ Ohne zu protestieren ließ ich mich von ihm wieder zu dem Sessel führen und ließ mich hineinfallen. Ich wartete, bis jeder wieder saß, blickte in ihre neugierigen Augen und versuchte, mich zu erinnern.
*Rückblick*
Ich saß einfach nur so da und starrte ins Leere. Aufgeregte Krankenschwestern zogen ebenso an mir vorbei wie stöhnende Patienten und Befehle gebende Ärzte. Ich sah sie alle. Ich konnte sie auch hören, doch ich nahm sie nicht wahr. Ich fühlte mich unfähig mich zu bewegen. Unfähig, meinen Kopf auch nur für wenige Millimeter zu drehen. Was zu viel ist, ist einfach zu viel. In diesem Jahr waren nicht nur zu viele Menschen gestorben, die ich aus ganzem Herzen geliebt hatte, sondern auch ein Teil meiner Welt. Ich war noch nicht einmal dazu in der Lage, zusammen zu zucken, als mich jemand überraschenderweise an der Schulter berührte.
„Anni?“ Ich hörte jemanden meinen Namen sagen und spürte, dass jemand sanft an meiner Schulter rüttelte. Doch ich wusste nicht wer es war. Ich fühlte mich außer Stande zu sagen, ob die Stimme zu einem Mann oder einer Frau gehörte. „Anni?“ Wieder nannte jemand meinen Namen und ein bekanntes Gesicht schob sich in mein vernebeltes Blickfeld. Es war Georgia. Irgendwie schaffte ich es meinen Kopf ein wenig zu heben und sah Mary ein paar Schritte hinter unserer Freundin stehen. Sagen konnte ich nichts. Was hätte ich auch sagen sollen? Worte hätten nichts geändert an dem kleinen Tod, den ich heute gestorben war.
Widerstandslos ließ ich zu, dass sich Georgia links und Mary rechts von mir unterhakte und die beiden mich aus dem Spital führten. Langsam und träge setzte ich einen Fuß vor den anderen, ohne dass ich meinen Beinen den Befehl dazu gegeben hätte. Hätte Mary und Georgia mich nicht festgehalten, ich wäre wohl der Länge nach hingeschlagen und einfach auf der Straße liegen geblieben, dem war ich mir sicher. Die große Leere, die ich verspürte, nahm jeden Zentimeter meines Körpers, meines Herzens und meiner Seele in Besitzt, als wäre ein Dämon in mich eingefahren, um mich von innen heraus aufzufressen. Erst als wir vor dem Haus stehen blieben, in dem ich einst ein glückliches Leben im Kreise meines Onkels, meiner Tante und Edward geführt hatte, kehrte wieder etwas Leben zurück in meine Geist und meine Glieder. Ich wollte nicht in dieses Haus gehen. Ich war mir sicher, dass ich genauso wahnsinnig werden wie Marys Mutter, wenn ich an den Ort zurück kehren würde, an dem mich alles an sie erinnern würde.
Jähe Panik ergriff mich. Ich riss mich von meinen Freundinnen los, die mich bereits zum Fuße der Portaltreppe geführt hatten und begann zu schreien. Für einen kurzen Moment registrierte ich Marys, vor Schreck geweiteten Augen, doch ich konnte keine Rücksicht darauf nehmen, ob ich irgendjemandem Angst einjagte. Ich wollte hier weg. Ich konnte nicht in dieses Haus gehen. „NEIN!“, schrie ich aus Leibeskräften, während ich auf meinen blanken Füßen kehrt machte, um in die andere Richtung zu laufen. Doch meine Beine trugen mich nicht ohne Hilfe. Ich geriet ins straucheln, wäre gestürzt, wäre Georgia nicht sofort zur Stelle gewesen und riss mich am Handgelenk wieder in die Senkrechte. Doch ihr fester Griff machte mir nur noch mehr Angst. Ich fürchtete, dass sie mich nun doch an diesen grauenvollen Ort der Erinnerungen bringen würde.
Durch mein Schreien, war nun auch Sidonie aufgeschreckt worden. Meinen Sohn auf dem Arm trat sie aus der Haustür und sah bedrückt zu uns herab. Ich bekam das nicht mit. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, mich von Georgia zu befreien. Ich riss heftig an meinem Arm, um ihn los zu bekommen, schlug nach meiner Freundin und versuchte ihre Haare zufasse zu bekommen, um sie ihr auszureißen. Ich war das perfekte Bild, einer verzweifelten und wild gewordenen Furie. „Anni! Hör sofort auf damit!“ Nun war auch Mary wieder aus ihrer Schreckensstarre erwacht und versuchte von hinten, mich von Georgia los zu reißen. Wir müssen schon ein äußerst seltsames Bild abgegeben haben. Drei Frauen, die sich im Vorgarten eines ziemlich vornehmen Hauses geradezu prügelten, wobei Mary nur unzureichend gekleidet war in der Hast der sie am Morgen hatte folgen müssen und ich, die ich lediglich im Nachthemd und Morgenmantel auf dem Rasenstand und immer wieder „NEIN! NEIN! NEIN!“, schreite.
Zu zweit waren die beiden dann allerdings doch stärker als ich. Sie keilten mich zwischen sich ein. Meine Arme hielten sie dabei so fest, dass ich sie kaum noch bewegen konnte. Meine Haut unter ihren Fingern wurde ganz weiß. „Wir bringe sie nach nebenan!“, bestimmte Mary, wobei sie einen unsicheren Blick zu ihrem Elternhaus warf. Mary hatte es vermieden, das Haus zu betreten, seit ihr Vater mit ihrer Mutter nach Oregon aufgebrochen war und nicht mehr zurück kehrte. Doch sie riss sich zusammen. Demonstrierte nicht so armselig wie ich, welche Angst sie vor den Erinnerungen an die Toten hatte. Stattdessen richtet sie sich zu ihrer vollen Größe auf und straffte die Schultern, wie sie es immer tat wenn eine Aufgabe vor ihr lag, die ihr alles abverlangte. Mit einem leisen Pfiff, blies sie sich eine verirrte Haarsträhne aus dem Gesicht, dann ging sie los. Unbarmherzig zwischen Georgia und Mary eingeklemmt hatte ich keine andere Wahl, als mit ihnen zu gehen. Sidonie folgte uns mit Tom.
In dem großen Herrenhaus war dunkel. Seit über einem halben Jahr war niemand mehr hier gewesen. Sidonie hatte im Auftrag meiner Tante die Möbel im Salon mit Bettlaken abgedeckt, damit der samtene Bezug vom Staub nicht zerstört werden konnte. Es wirke ein wenig wie ein Geisterhaus. Spinnenweben hingen in jeder Ecke unter den Decken und das dunkle Holz der großen Treppe, die in die obere Etage führte hatte den Glanz aus früheren Tagen verloren. „Wir bringen sie am besten in mein Zimmer“, ordnete meine Schwägerin nach einem kurzen Moment des Schweigens schließlich an. Scheinbar hatte sie einen Moment lang darüber nachgedacht, mich in Thomas´ altem Zimmer unterzubringen. Das allerdings wäre meinem Zustand wohl nur wenig dienlich gewesen. Ich wehrte mich jetzt nur noch kaum gegen die festen Griffe meiner Freundinnen und lies mich von ihnen nach oben bringen.
Die Türen zu den Schlafzimmern waren verschlossen und die Tür zu Marys Zimmer quietschte laut, als sie aufgestoßen wurde. Im Inneren des großzügig geschnittenen Raumes sah es ebenso aus, wie in jedem Mädchenzimmer. Es gab eine Frisierkommode, auf der ein paar Flakons mit Flüssigkeiten standen. Ein Schmuckkämmchen lag einsam auf der ansonsten leeren Tischplatte. Die mit reichlichen Schnitzereien verzierten Schubladen, waren alle sorgsam verschlossen. Es war wahrscheinlich, dass sie dieselben Geheimnisse beherbergten, wie die Frisiertische anderer junger Frauen auch. Briefe von heimlichen Verehrern, kleine Dinge die man gefunden hat und an denen man Gefallen gefunden hatte, ein Buch, dass an aus Gründen der Anstandswahrung als Frau auf gar keinen Fall lesen sollte und so weiter und so fort. Vor der Kommode stand ein Hocker aus demselben dunklen Ebenholz aus dem fast alle Möbel im Haus der Sommers gefertigt war. Ebenso das große Bett von Mary, das zwar ordentlich gemacht war, allerdings voller Staub. Am Fuße des Bettes stand eine große Kiste, in der Marys Kleider eins gelagert wurden, bevor Sidonie sie zu uns rüber geholt hatte. Unter einem der großen Fenster gab es ein breiteres Fensterbrett, auf dem dünne Kissen lagen und zu hinsetzen einluden. Eine abgeliebte Puppe aus Porzellan, in einem ausgeblichenen gelben Kleid saß dort und betrachtete uns stumm.
„Ich beziehe das Bett neu.“ Sidonie war wie immer sofort zur Stelle, wenn es darum ging Ordnung und Sauberkeit wieder herzustellen. „Miss Anni?“ Mit einem stechenden Blick, der mich dazu auffordern sollte, mich zusammen zu reißen, hielt sie mir meinen Sohn hin. Ich zögerte kurz und sah zu Mary und Georgia. Letztere nickte und sie ließen meine Arme los, damit ich meinen Sohn halten konnte. Sanft drückte ich seinen kleinen Kopf an meine Wange, während ich ihn in meinen schmerzenden Armen wiegte und ein wenig Wärme kehrte zurück in mein Herz.
Die folgenden Wochen zogen einfach so an mir vorbei. Die Sonne ging morgens auf und abends wieder unter aber das war auch schon das einzige, das noch so war, wie früher. Alles andere hatte sich verändert. Nur Tom schaffte es hin und wieder mich aus meiner tiefen Lethargie zu reißen. Er brauchte mich. Er war ein Teil von mir. Es war meine Pflicht als seine Mutter mich um ihn zu kümmern und ihm die Liebe und Freude zu schenken, die er brauchte. Nur langsam fand ich wieder zu mir selbst zurück, beziehungsweise zu dem, was von mir selbst noch übrig war. Mary schaffte es sogar, mich nach zwei Wochen zu überreden, rauszugehen um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Ich war blass und sah krank aus. Versuchte mich auf das Gespräch zu konzentrieren, dass Mary mehr mit sich selber führte. „Misses Dashworth hat erzählt, dass die spanische Grippe nun langsam wieder nachlässt. Es gibt kaum noch neue Opfer und immer mehr Erkrankte überleben. Und Georgia meinte, dass viele Ärzte im Krankenhaus glauben, dass dieser Fluch nun langsam abziehen würde. Also das Grippe nicht wie beim letzten Mal nur eine Pause einlegt, sondern, dass sie ganz verschwindet. Ein Arzt hat deswegen wohl gestern auch gekündigt weil er meinte, hier in Chicago würde nun nicht mehr so viel Hilfe benötigt wie anderer Orts.“ Ich lauschte ihren Worten angestrengt und versuchte jeden Blick zu dem Haus zu vermeiden, in dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht hatte.
Doch es gelang mir nicht. Unbewusst glitt mein Blick immer wieder zu dem Gebäude aus weißem Sandstein. Mit der schweren Holztür die offen stand. Verwundert blieb ich stehen und Marys Blick folgte dem meinen. Sie spürte meine Verwunderung und dieselbe Vermutung keimt in ihr auf, wie in mir. „Vielleicht ist Sidonie kurz rüber gegangen um etwas zu holen?“, versuchte sie uns beide zu beruhigen, doch leider ohne Erfolg. „Sidonie ist auf dem Markt.“ Meine Stimme klang heiser, weil ich so lange geschwiegen hatte. Unwillig aber mit großen Schritten bewegte ich mich auf das Portal zu, überwand meine Angst und stieg die Treppe zur Haustür hinauf. Vorsichtig blickte ich durch die geöffnete Tür ins Innere des Hauses. „Hallo?“ Meine Stimme war leise und ich hätte wahrscheinlich auch keine Antwort bekommen, wenn irgendjemand mich gehört hätte.
„Wir sollten da besser nicht rein gehen.“ Mary war mir die Stufen hinauf gefolgt und hinter mir zu stehen gekommen. Auch sie blickte verängstigt, über meine Schulter in die Dunkelheit im Inneren. Ich scherte mich nicht um ihre Bedenken und trat ein. Ich musste es einfach tun. Ich brauchte Gewissheit. In der großen Halle sah alles aus wie immer, aber das war auch nicht weiter verwunderlich. Sollten wirklich Einbrecher hier gewesen sein, so hätten sie in der Halle nichts von Wert gefunden. Im Salon allerdings wurde meine Befürchtung bestätigt. Sämtliche Schranktüren waren aufgerissen worden. Auf den ersten Blick fiel mir auf, dass die Schatullen mit den Barschaften meines Onkels verschwunden waren. Auch dass der Schrank hinter dem Schreibtisch meines Onkels, verdächtig zur Seite geschoben worden war, bereitete mir Sorgen. Mit zitternden Knien ging ich darauf zu und mit Entsetzen sah ich das leere Loch in der Wand hinter dem Schrank. Hier hatte jemand genau gewusst, wonach er suchte. Ich schluckte schwer. Nur einmal hatte ich die kleine Kiste aus Holz gesehen, die mit rotem Seidenbrokat bezogen worden war. Nur einmal hatte meine Tante mir ihren ganz persönlichen Schatz gezeigt. Die Diamanten, die bereits seit Generationen in ihrer Familie waren.
Ich war zehn gewesen, als meine Tante mich in dieses kleine Geheimnis einweihte. Andächtig hatte sie die schöne Schachtel aus ihrem Versteck geholt und mir den Inhalt gezeigt. Als ich die Pracht der Edelsteine darin sah stockte mir fast der Atem. Drei kleine Anhänger lagen, auf Seide gebettet darin. In ihrer Lupenreinheit brach sich der Sonnenschein der durch die Fenster drang und erzeugte tanzende Regenbogen. Jeder Anhänger war in mühevoller Kleinarbeit in verschiedene Formen gebracht worden. Ein Anhänger war ein in Gold gefasstes Oval. Ein weiterer ein kleines Herz. Und der dritte war ein kleiner Schmetterling, der wundervoll funkelte. Ich konnte nicht aufhören ihn anzusehen.
„Weißt du Liebes“, hatte meine Tante gesagt und mir liebevoll mit einem Finger über die Wange gestreichelt. „diese Steine sind Familienerbstücke. Wenn ich eines Tages sterbe, dann wird Edward sie bekommen, damit seine Frau sie tragen kann und später an ihre Kinder weitervererbt.“ Meine Enttäuschung überspielend versuchte ich möglichst verständnisvoll zu nicken. Ich war es bereits gewöhnt, dass ich niemals ganz zu dieser Familie gehören würde. Ich wurde geliebt und niemals hätte man mich spüren lassen, dass ich nur ein Ziehkind war. Aber es waren eben die kleinen Momente, die sich wie ein glühendes Messer in mein kleines Herz bohrten. Ein Lächeln umspielte die Lippen meiner Tante, als sie weiter sprach. „Da du aber genauso mein Kind bis wie Edward, will ich, dass du den Schmetterling bekommst. Er soll dich daran erinnern, wer du bist und zu wem du gehörst.“ Ehrfürchtig sah ich zu ihr auf. Der Mund stand mir ein Stück weit offen. „Mach den Mund zu.“ Einen Zeigfinger unter mein Kinn gelegt, schloss meine Tante meinen Mund, bevor sie mir einen Kuss auf die Schläfe hauchte. „Du weißt genau wie sehr ich die liebe.“
Und jetzt? Meine Tante war tot. Edward ebenfalls. Und auch ein Schmetterling aus Diamant hätte diesen Verlust niemals wieder gut machen können. Doch für einen kurzen Moment fragte ich mich, wie ich mich denn nun daran erinnern sollte, wer ich bin und zu wem ich gehöre. Ich schluchzte laut, als mich die Erkenntnis fest in ihren Schraubstock nahm.
Ich wusste nicht mehr wo ich bin und wo mein Platz im Leben war.
*Rückblickende*
Gast- Gast
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten
 Startseite
Startseite